Wer sich auf das Feld der Medizinethik wagt, bewegt sich in einem Spannungsraum aus existenziellen Fragen, tief verwurzelten Überzeugungen, emotionaler Betroffenheit und gesellschaftlichen Konfliktlinien. Die Medizinethikerin Alena Buyx, Professorin für Medizinethik an der Technischen Universität München und ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, hat mit „Leben und Sterben – die großen Fragen des Lebens ethisch entscheiden“ ein Buch geschrieben, das in diese schwierige Gemengelage Klarheit, Ruhe und Orientierung bringt.
Auf nur etwa 300 Seiten gelingt es Buyx, in methodischer Klarheit, wertschätzendem Ton und ethischem Tiefgang ein Buch zu verfassen, das ein breites interessiertes Publikum zum Mitdenken anregt. Buyx gibt keine endgültigen Antworten, sondern ermutigt dazu, eine gut reflektierte und wohlbegründete Position zu entwickeln. Zu Beginn führt sie in die Grundlagen der Prinzipienethik nach Beauchamp und Childress ein, die als Ausgangspunkt für ihr medizinethisches Urteilen dienen: Fürsorge, Nichtschaden, Autonomie und Gerechtigkeit. Auf diese vier Prinzipien nimmt sie in den folgenden Kapiteln immer wieder Bezug.
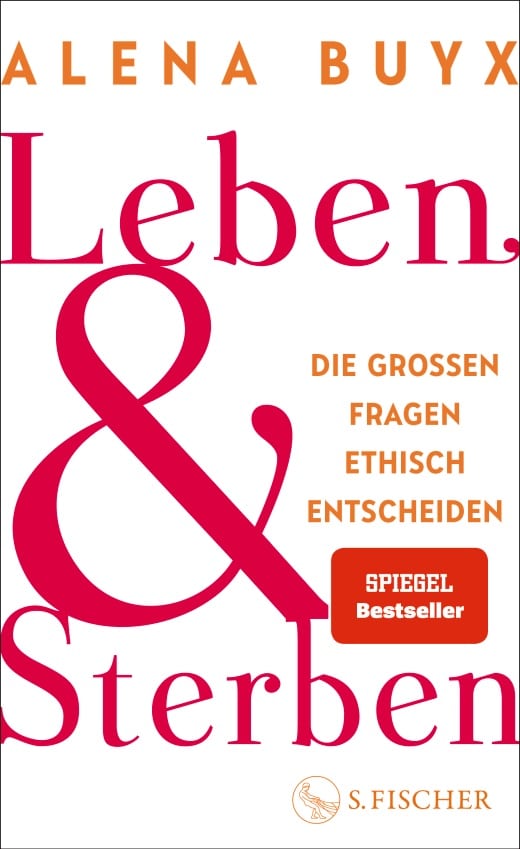
Alena Buyx: „Leben und Sterben. Die großen Fragen ethisch entscheiden“, S. Fischer, 304 Seiten, 24 Euro
Im ersten Kapitel („Werden“) geht es um Fragen des Lebensbeginns: Therapieziele bei extremen Frühgeburten, pränatale Diagnostik, Embryonenschutz, Fortpflanzungsmedizin. Buyx schildert komplexe Fälle aus ihrer ärztlichen Praxis und entfaltet daran spannende ethische Dilemmata. Religiöse Positionen – etwa der Lebensschutz als göttlicher Auftrag – werden von ihr ausdrücklich gewürdigt. Sie bezeichnet sie als „partikulare“ Argumente, die in einer historisch christlich geprägten Gesellschaft weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Zugleich macht sie deutlich, dass solche Überzeugungen in der heutigen weltanschaulich pluralen Gesellschaft nicht normgebend sein können. Gleichzeitig bringt sie philosophisch-allgemein zugängliche Argumente ein, die auch in christlicher Ethik Anschluss finden.
Anschließend führt Buyx im Kapitel „Sterben“ die Leserschaft kenntnisreich in zentrale Entscheidungsoptionen am Lebensende ein. Begriffe wie aktive und indirekte Sterbehilfe, Therapieverzicht oder das Beenden lebensverlängernder Maßnahmen werden sorgfältig erläutert und in ihren juristischen wie medizinischen Bedeutungen klar konturiert. Besonders behutsam nähert sich Buyx dem Thema der Suizidassistenz. Unter dem Eindruck eines persönlichen, bewegenden Beispiels einer an ALS erkrankten Frau plädiert Buyx für die Möglichkeit eines Zugangs zur Suizidassistenz in klar begrenzten Ausnahmesituationen, vorausgesetzt, die Entscheidung erfolgt freiverantwortlich. Zugleich stellt sie mit Nachdruck klar: Suizidprävention hat Vorrang. Die meisten Suizidwünsche, so ihre Einschätzung, entspringen sozialen, medizinischen oder seelischen Notlagen, die sich verändern lassen. Es sei daher keineswegs ethisch vertretbar, jeden Wunsch nach Suizidassistenz sofort zu erfüllen.
» „Es braucht mehr Aufklärung über Alternativen zum assistierten Suizid“
Für christliche Leser ist es wichtig wahrzunehmen: Buyx begründet ihre Position nicht theologisch, etwa mit einer Vorstellung von Gott gegebener Würde, sondern argumentiert innerhalb eines säkularen ethischen Rahmens, in dem insbesondere die Prinzipien Autonomie und Fürsorge miteinander ins Gleichgewicht gebracht werden. Dennoch zeigt Buyx auch in diesem Kapitel Respekt gegenüber religiös motivierten Ablehnungen der Suizidassistenz. Sie habe großes Verständnis dafür, wenn beispielsweise konfessionelle Einrichtungen grundsätzlich keine Suizidassistenz anbieten. Was ihre Analysen durchzieht, ist ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein – getragen von dem Bemühen, sowohl individuelles Leid ernst zu nehmen als auch gesellschaftliche Folgen mitzudenken. Dieses Verantwortungsdenken öffnet an vielen Stellen den Dialog mit christlicher Ethik.
Menschliche Intelligenz nicht ersetzbar
Nach den existenziellen Fragen am Lebensende widmet sich Buyx im Kapitel „Sorgen“ dem medizinischen Alltag: Welche Therapieziele sind im Falle einer Krebsdiagnose angemessen? Welche Faktoren spielen bei der Entscheidungsfindung eine Rolle? Was bedeutet informierte Einwilligung? Und welchen Stellenwert nimmt die Selbstbestimmung in Behandlungsentscheidungen ein? Im Zentrum steht der kulturelle Wandel von einem paternalistischen hin zu einem partnerschaftlichen Arzt-Patienten-Verhältnis, bei der der individuelle Wille auch ärztliche Empfehlungen überwiegen kann. Anhand konkreter Fallbeispiele zeigt sie, wie anspruchsvoll es für beide Seiten sein kann, einen verantwortlichen Weg zwischen ärztlicher Fürsorge und Patientenautonomie zu finden.
Im letzten Kapitel („Formen“) öffnet Buyx den Blick auf neue Technologien, die ihren Lehrstuhl besonders beschäftigen: Pflegeroboter, KI-gestützte Diagnostik, Chatbots für psychische Unterstützung. Sie benennt klar die Chancen, ohne die Risiken zu verschweigen: Künstliche Intelligenz ist eine Dual-Use-Technologie – sie kann Medikamente entwickeln, aber auch Biowaffen. Ihre Haltung ist vorsichtig optimistisch: Die neuen Technologien werden ethisch begleitet, was sich beispielsweise zuletzt in internationalen KI-Abkommen gezeigt hat. Besonders interessant: Ihre Abgrenzung menschlicher Intelligenz von künstlicher. Menschen denken und handeln sozial, emotional, intuitiv, kreativ, geschichtlich – das sei nicht ersetzbar. Wer an die Gottebenbildlichkeit des Menschen glaubt, wird hier zustimmend nicken.
Das Buch ist stilistisch leicht zugänglich, dialogisch geschrieben und gut strukturiert. Es eignet sich für Laien ebenso wie für medizinisch Vorgebildete. Zahlreiche Fallbeispiele, persönliche Erfahrungen und manche humorvolle Bemerkung machen die Lektüre lebendig und kurzweilig. Eine ausführliche Literaturliste lädt zur Vertiefung ein.
„Leben und Sterben“ ist kein christliches Ethikbuch – aber ein hoch respektvolles Gesprächsangebot an Gläubige und Nichtgläubige gleichermaßen. Es sensibilisiert für die schwierigen Fragen, die in der Medizin mitunter getroffen werden müssen, eröffnet Denk- und Reflexionsräume und spricht dank seiner unpolemischen Nüchternheit ein breites gesellschaftliches Spektrum an. Für Leser, die ihre christlich-ethischen Positionen im Lichte des pluralen Diskurses vertiefen möchten, ist dieses Buch eine lohnenswerte Lektüre.
Judith Khoury, Jahrgang 1995, hat Medizin, Theologie und Public Health studiert. Sie ist als Referentin für Medizinethik bei bei der Stiftung „Provita“ sowie bei der Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner, einem Fachverband der Studentenmission Deutschland (SMD), tätig.

