Julia Ruhs ist so etwas wie das konservative Gesicht des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Oder sie wird von diesem gerade dazu gemacht. Sie scheint jedenfalls in diese Rolle gut hineinzupassen, weil sie kein alter weißer Mann ist, von dem man konservative Positionen erwarten würde, sondern Jahrgang 1994 und weiblich.
Größere öffentliche Aufmerksamkeit zog sie auf sich, als sie sich als Volontärin beim Bayerischen Rundfunk im ARD-Mittagsmagazin gegen das Gendern aussprach und sich einen Shitstorm in den sozialen Medien einhandelte. Ende 2023 bezog sie in ihrem ersten Kommentar für die „Tagesthemen“ Position für mehr Abschiebungen – und „die linksgrüne Schnappatmung brach aus“. So formuliert sie es in ihrem Buch „Links-grüne Meinungsmacht. Die Spaltung unseres Landes“, das im August erschienen ist.
Seit November 2023 arbeitet sich Ruhs in ihrer Kolumne „Regt euch doch auf“ auf focus.de an einem links-grünen Zeitgeist ab – Wokeness, Kampf gegen „rechts“, Gendern, Staatshörigkeit, Kopftuch, Weltretter-Haltung der Medien. Auch ihre eigenen Erfahrungen mit den Reaktionen auf ihre Beiträge lässt sie in die Texte einfließen.
Spätestens aber mit dem ARD-Format „Klar“ über Streitthemen der Gesellschaft dürfte sie zumindest in Teilen der Medienwelt zu einer Reizfigur geworden sein. In der ersten von drei Pilotfolgen dieser Reportagesendung thematisiert Ruhs negative Folgen der Migration. Sie begleitet unter anderem einen Mann, dessen Tochter von einem abgelehnten Asylbewerber erstochen wurde. Die Sendung löste eine Welle der Empörung aus. In den zwei weiteren Folgen geht Ruhs dem Frust der Bauern und den Folgen der Corona-Krise für die Gesellschaft nach. Ob es weitere Folgen gibt, entscheidet der produzierende NDR nach einer internen Auswertung.
Klage über bevormundende Medien
Nun hat Ruhs ihr erstes Buch veröffentlicht. Anders, als es der Titel vermuten lässt, ist es keine plumpe Abrechnung mit den oft so gescholtenen „links-grün versifften Medien“. Ruhs beschreibt vor allem ihre persönliche Sicht und eigene Erfahrungen damit, wie sie mit ihren konservativen Ansichten im medialen Diskurs aneckt und feststellt, dass diese nicht Mainstream sind. Zu einem großen Teil lebt ihr Buch davon, dass sie Rückmeldungen zitiert, die sie von Lesern und Zuschauern bekommt. Daran knüpft sie ihre eigenen Ausführungen an. Zur Unterstützung ihrer Argumentation zitiert sie auch Studien und andere Beobachter des Zeitgeschehens.
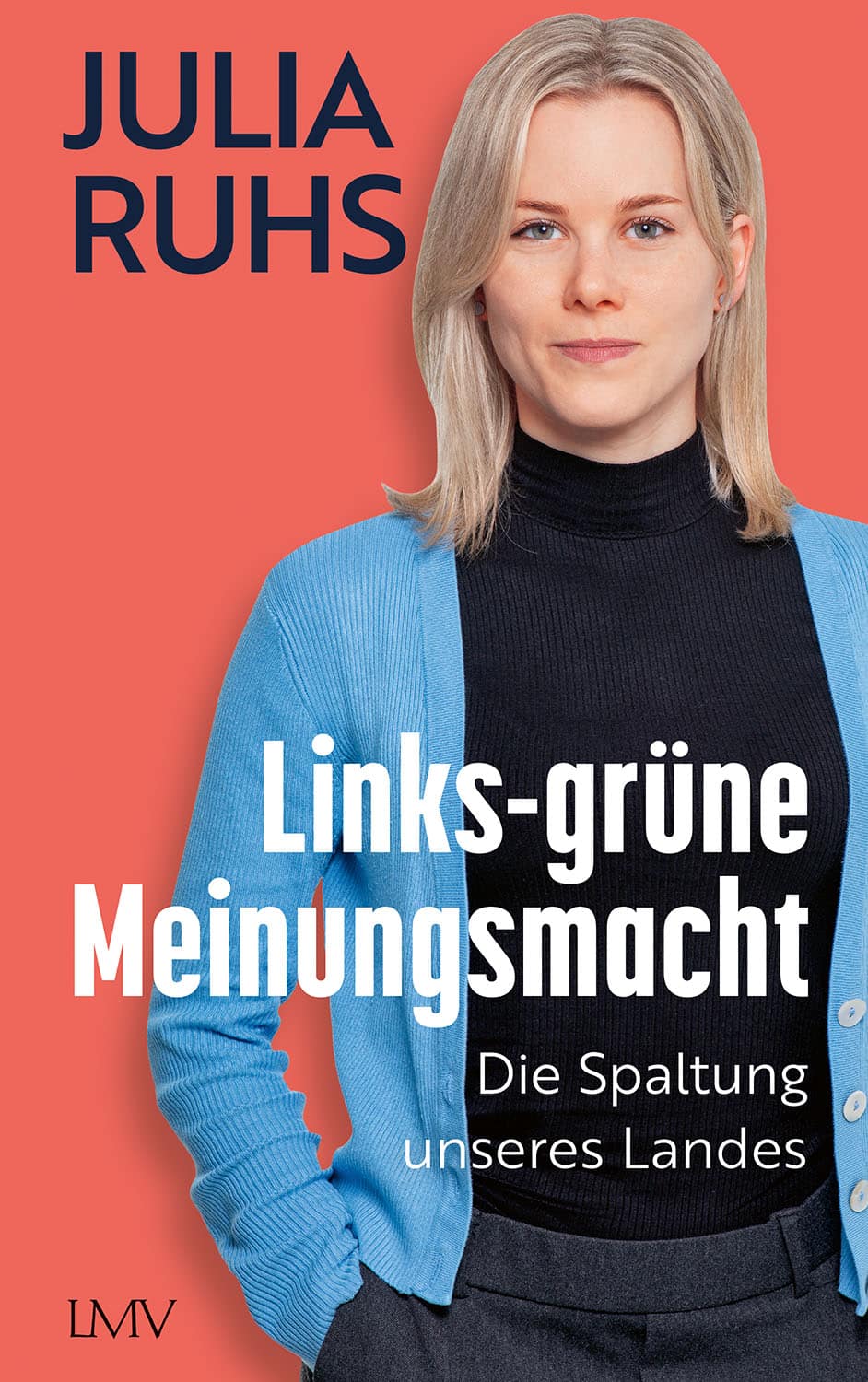
Julia Ruhs: „Links-grüne Meinungsmacht. Die Spaltung unseres Landes“, Langen Müller, 208 Seiten, 20 Euro
Die inhaltliche Richtung ist dabei schnell klar: Es sind Klagen über bevormundende und moralisierende Medien, einen verengten Meinungskorridor, Abwehrreflexe gegen „rechts“, aktivistische Journalisten, Haltungsjournalismus, die Sehnsucht nach gesellschaftlichem Konsens, oder die Angst, die eigenen Ansichten kundzutun, wenn diese vom vermeintlichen Konsens abweicht. Ihre Argumentation läuft darauf hinaus, dass diese Tendenzen dazu führen, dass sich Menschen von den Medien abwenden und ihnen das Vertrauen entziehen. Auf politischer Ebene sei dadurch die AfD stark geworden.
Zugleich versucht Ruhs die Balance, nicht bei einseitiger Medienkritik stehenzubleiben, sondern Dinge auch zu erklären: etwa, warum viele Journalisten politisch eher links und grün ticken, was das mit der Sozialisation zu tun hat und mit dem Berufsfeld an sich. Wie soziale Medien den Journalismus herausfordern und seine Rolle in der Gesellschaft infrage stellen. Dass Journalisten sich wie in einer Herde oft aneinander orientieren.
Sie weist auch darauf hin, dass man als Mediennutzer dazu neigt, völlig neutral gehaltene Beiträge grundsätzlich negativer zu bewerten, wenn sie nicht die eigene Meinung widerspiegeln. Und sie betont, dass die öffentlich-rechtlichen Medien immer noch sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung genießen.
An ihre Journalistenzunft gerichtet, wirbt sie dafür, das Publikum und seine Ansichten ernst zu nehmen. „Medien sind keine Hüter der Wahrheit“, schreibt sie. Wenn klassische Medien bestimmte Positionen und Themen ignorierten, würden andere dafür einspringen – Influencer, Alternative Medien. Der Bruch in der Gesellschaft sei auch zu einem medialen Bruch geworden.
Neu sind diese Befunde nicht, deshalb verwundert es, dass Ruhs fast 200 Seiten braucht, um ihr Anliegen – so wichtig es ist – zu verdeutlichen: ein ausgewogener öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Gerade die an den Medien geübte Kritik ermüdet streckenweise, weil sie sich immer wieder um ähnliche Themen dreht und durch diesen Fokus der Blick auf die inhaltliche Vielfalt der Medien, auch der öffentlich-rechtlichen, verloren geht.
Eingezwängt im Lagerdenken
Dass Julia Ruhs einen Nerv getroffen hat, zeigen die Reaktionen auf ihr Buch: Medien wie „Zeit“, „Spiegel“ und „Süddeutsche“ haben große Stücke über sie veröffentlicht. Auch eine ganze Reihe weiterer Medien haben über ihre Positionen berichtet – inklusive des Attributs, sie sei „umstritten“. Auf der „Spiegel“-Bestsellerliste lag es kurz nach Erscheinen auf Platz 7.
Wie links sind die Medien?
Dass Journalisten tendenziell eine Partei links der Mitte wählen, haben verschiedene Befragungen festgestellt. Aber heißt das, dass sie auch politisch verzerrt berichten? Forscher der Universität Mainz haben ausgewertet, über welche Themen und Akteure Medien zwischen April und Juni 2023 berichteten, wenn es um Politik ging, wie sie die Akteure bewerteten und wie sich die Medien ideologisch verorten ließen. In die Analyse flossen neun öffentlich-rechtliche Nachrichtensendungen sowie 34 der reichweitenstärksten privaten Medien ein sowie vier Publikationen der politischen Ränder.
Es zeigte sich, dass sowohl öffentlich-rechtliche als auch private Medien eine große Vielfalt an Themen und Akteuren aufwiesen. In beiden Mediengruppen ging es aber häufiger um die Regierungsparteien als um die der Opposition. Die politischen Akteure wurden durchweg häufiger negativ als positiv dargestellt. Dabei kamen die damaligen Regierungsparteien der Ampel bei den öffentlich-rechtlichen besser weg als die Oppositionsparteien. Bei den privaten Medien war das Verhältnis ausgeglichener. Fast alle, insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien, ließen sich darüber hinaus als sozialstaatsorientiert und liberal-progressiv verorten.
Von den öffentlich-rechtlichen Formaten waren nur „heute“ und BR24 eher konservativ ausgerichtet und insgesamt am ausgewogensten. Die Forscher stellten aufs Ganze gesehen eine „leichte Linksschiefe des Mediensystems“ fest. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei dabei nicht besonders einseitig, allerdings auch nicht vielfältiger als private Medienangebote. Ein anderer Untersuchungszeitraum und andere Formate könnten jedoch zu anderen Ergebnissen führen.
Vieles, was Ruhs schreibt, wird ihre Kritiker aufregen. Vielen anderen dürfte sie aus dem Herzen sprechen, die eine politische Schlagseite in den Medien wahrnehmen, und sich von der Berichterstattung nicht repräsentiert fühlen. Ruhs schenkt ihnen Gehör und Stimme. Sie tut das mit einem persönlichen Ton (das Vorwort schließt sie mit „Eure Julia Ruhs“), mit dem sie eine Nähe zu ihren Lesern suggeriert. So wirkt die Autorin wie eine Anwältin der ungehörten Mediennutzer. Diejenige, die konservative Anliegen in den Medien noch hochhält.
Und das ist vielleicht das Schwierige an dem Buch: Ruhs möchte als junge, konservativ eingestellte Journalistin vermitteln zwischen ihrem Publikum und dem linksliberalen Medienmainstream. Sie fordert richtigerweise offene Debatten und die Bereitschaft, unterschiedliche Meinungen auch jenseits eines Mainstreams auszuhalten. Von den Medien erwartet sie, sich inhaltlich mehr am gesellschaftlichen Durchschnitt zu orientieren. Doch dabei bleibt sie in einem Lagerdenken verhaftet – konservativ versus progressiv. Die Reaktionen in Medien und Kommentaren spiegeln das wider. Weil die Gesellschaft konservativer tickt als die Medien, müsste die konservative Perspektive stärker in der Berichterstattung vorkommen, damit sie ausgewogen ist. So könnte man nach der Lektüre resümieren.
Das ist nicht falsch. Doch hilft dieser Dualismus wirklich dabei, die Welt zu verstehen? Dient es dem Anliegen der Ausgewogenheit, sich als konservativ zu profilieren, wie es übrigens auch andere tun, oder dient das eher der Markenbildung? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte außerdem aufpassen, dass Formate wie „Klar“ oder Journalistinnen wie Ruhs nicht zum Alibi dafür werden, ja doch auch mal gegen den Mainstream zu bürsten.
Wenn es schon um besseren Journalismus geht, wäre es doch wünschenswert, das Schema von rechts und links, konservativ und progressiv würde für Journalisten gar keine Rolle spielen. Sie sollten grundsätzlich fürs Publikum relevante Themen aufgreifen und möglichst viele Facetten davon beleuchten, ohne dass sie damit eine politisch-ideologische Kategorie bedienen. Denn in der Wirklichkeit überwiegen die Zwischentöne.

