PRO: Die Welt ist verrückt geworden, das sagt der Titel Ihres Buchs. Woran merken Sie das?
Markus Spieker: Egal ob Trump, Ukraine oder Künstliche Intelligenz, an ganz vielen Stellen merken wir, dass sich etwas im wahrsten Sinne ver-rückt. Also transformiert. Und auch die Art, wie wir darauf reagieren, ist verrückt. Die wenigsten sehen Dinge realistisch, sondern jeder ist in seiner Blase und nimmt die Realität gefiltert wahr.
Ihr Buch heißt im Untertitel: „Wie man in verrückten Zeiten einen klaren Kopf behält“. Wann haben Sie denn Ihren klaren Kopf zuletzt mal verloren angesichts der Weltlage?
Dauernd. Ich lebe ja auch in dieser gefilterten Welt, wünsche mir, dass Medien meine Weltsicht bestätigen, und will mich ungern in meinen Ansichten verändern. Debatten wie die um den Tod von Charlie Kirk, um das Schuldenpaket oder Meinungsvielfalt im öffentlichen Diskurs betreffen mich. Meine Haltung würde ich beschreiben als christlich-humanistischen Realismus. Ich will versuchen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Ich will mich am Menschenwohl orientieren. Und ich will hoffnungsvoll sein. Manchmal muss ich mich zu dem allen aber durchaus zwingen.
„Ich will versuchen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Ich will mich am Menschenwohl orientieren. Und ich will hoffnungsvoll sein. Manchmal muss ich mich zu dem allen aber durchaus zwingen.“
Was hat Ihnen da geholfen?
Wenn ich in einem Film eine Szene sehe, die mir unangenehm ist, dann stelle ich mir vor, wie der Kameramann und der Tonassistent da drum herum stehen, und mache mir klar: Es ist nur ein Film. Beim Tagesgeschehen mache ich das genauso. Ich sage mir: Es ist nur ein Tag in einer sehr langen Geschichte, es geht mal bergauf und mal bergab, das ist normal. Wenn man die Nachrichten von vor 40 Jahren anschaut: Da ist die Welt dauernd untergegangen: Waldsterben, Aids, Atomwaffen. Ich habe mir angewöhnt, einen Schritt zurückzutreten und analytisch auf die Dinge zu blicken.
„Crazy World“ will drei Dinge erreichen: Es soll helfen, die Welt zu verstehen, das Land zu verbessern und uns selbst zu verändern. Warum ausgerechnet das Land verbessern und nicht die Welt?
Das hat mit meinem Realismus zu tun. Wir können anderen nicht helfen, wenn wir den eigenen Laden nicht im Griff haben. Ich wünsche mir, dass wir zufriedener sind in Deutschland, um dann aus einer intakten Position heraus die Probleme der Welt in den Griff zu bekommen.

Zur Person: Markus Spieker
Markus Spieker ist Chefreporter beim MDR in Leipzig. Als Reporter hat er schon weltweit gearbeitet, unter anderem in Afghanistan und Indien. Spieker ist Autor verschiedener Bücher, unter anderem „Jesus. Eine Weltgeschichte“ oder „Übermorgenland. Eine Weltvorhersage“.
Es mangelt an Exzellenz in Deutschland, schreiben Sie.
Wir brauchen eine Kultur, die uns dazu motiviert, über uns selbst hinauszuwachsen. Potenziale auszuschöpfen. Wir sollten nicht immer mit dem Zweitbesten zufrieden sein. Wir brauchen Top-Bildung, Top-Fachkräfte und so weiter.
Führungspersönlichkeiten, so schreiben Sie, sollten kompetent, integer und charismatisch sein. Trifft das auf unsere Politiker und andere Leiter zu?
Diese drei Faktoren kommen selten zusammen, selbst wenn eine Führungspersönlichkeit nur zwei auf sich vereint, ist das schon viel. Nehmen wir zum Beispiel unsere Bischöfe. Da ist wenig kommunikatives oder kreatives Talent, wenig Strahlkraft, vor allem im Zusammenspiel mit ihren oft herausfordernden Botschaften. Das Gesagte lässt sich dann entsprechend schwer verdauen. Und in der Politik ist es auch so: Wir brauchen mehr Menschen mit kommunikativem Talent. Schon die Weimarer Republik ist an ihren schwachen Führungspersönlichkeiten zugrunde gegangen: Hitler hatte keine adäquaten Gegenspieler. Ich bete: Gott, schenke uns Menschen, die Fähigkeiten haben, Charisma und die gut sind.
„Wir brauchen eine Kultur, die uns dazu motiviert, über uns selbst hinauszuwachsen. Potenziale auszuschöpfen. Wir sollten nicht immer mit dem Zweitbesten zufrieden sein.“
Viele sind besorgt über den derzeitigen Rechtsruck in Deutschland. Sie schreiben: „Was uns droht, ist nicht Nationalsozialismus, sondern Nationalegoismus.“ Was meinen Sie damit?
Nationalsozialismus war genozidal, absolut zerstörerisch. Aber nicht alle Bewegungen, die sagen: „Mein Land zuerst“, sind so. America-First-Politik zum Beispiel ist zunächst nationalegoistisch. Das ist eine Art Stammesdenken. Und da kommen wir alle her: Wir tun uns zusammen, setzen uns ums Lagerfeuer, gerade in Krisenzeiten, und schmieden Pläne gegen den bösen Gegner. Das ist seit tausenden von Jahren Menschheitsgeschichte so. Man kann das problematisch finden. Aber es ist nicht dämonisch, so wie Hitler es war. Das anzuerkennen, ist wichtig für die Analyse und die Problembehebung. Weil es Einfluss hat auf die Frage: Mit wem bin ich noch bereit zu reden und mit wem nicht. Es hat Einfluss auf Brandmauern und Debatten. Rechte Parteien wie die AfD gibt es weltweit und man muss sich mit ihnen auseinandersetzen.
Ist der Rechtsruck also weniger schwerwiegend als die meisten denken?
Dazu muss man erst die Frage beantworten, ob er Krankheit oder Symptom ist. Ich würde sagen, letzteres. Deshalb geht er auch nicht weg, wenn wir eine Partei verbieten.
Sie kritisieren stattdessen den „Wokismus“.
Wir haben in den vergangenen Jahren eine falsche Art von Gruppendenken gefördert. Bestimmte Personengruppen und deren Rechte sind sehr in den Vordergrund getragen worden, woraufhin auf der anderen Seite der Eindruck entstanden ist: Ich komme hier nicht mehr vor und bin abgehängt. Das hat Widerwillen und Abwehr ausgelöst. Ich finde die Debatten darum, was man wie sagen darf und muss, Stichwort Gender, völlig verrückt.
Sind die Ideen von Diversität und Nachhaltigkeit gescheitert?
Nein, denn wir haben doch eine recht bunte Gesellschaft. Für mich persönlich hat die Balance in den ersten 15 Jahren dieses Jahrhunderts halbwegs gestimmt. Da waren Vielfalt, Inklusion, Umweltbewusstsein gesellschaftliche Ziele, die von den allermeisten akzeptiert wurden. Eben weil die eigenen Freiheitsspielräume intakt blieben. Doch dann wurde es zunehmend bevormundend, dogmatisch, manchmal sogar autoritär. Dann ist die Stimmung gekippt.
Inwiefern?
So schön es ist, wenn Leute für eine bunte Gesellschaft werben: Wir brauchen nicht von Frühjahr bis Herbst jede Woche irgendwo einen Christopher Street Day mit dem entsprechenden medialen Begleitprogramm. Das ist schon massiv, besonders im Vergleich zu anderen Demonstrationen, etwa wenn es um den Schutz des ungeborenen Lebens geht. Ich sehe da eine Schieflage, auch wenn ich niemandem das Recht nehmen möchte, für seine Belange zu demonstrieren.
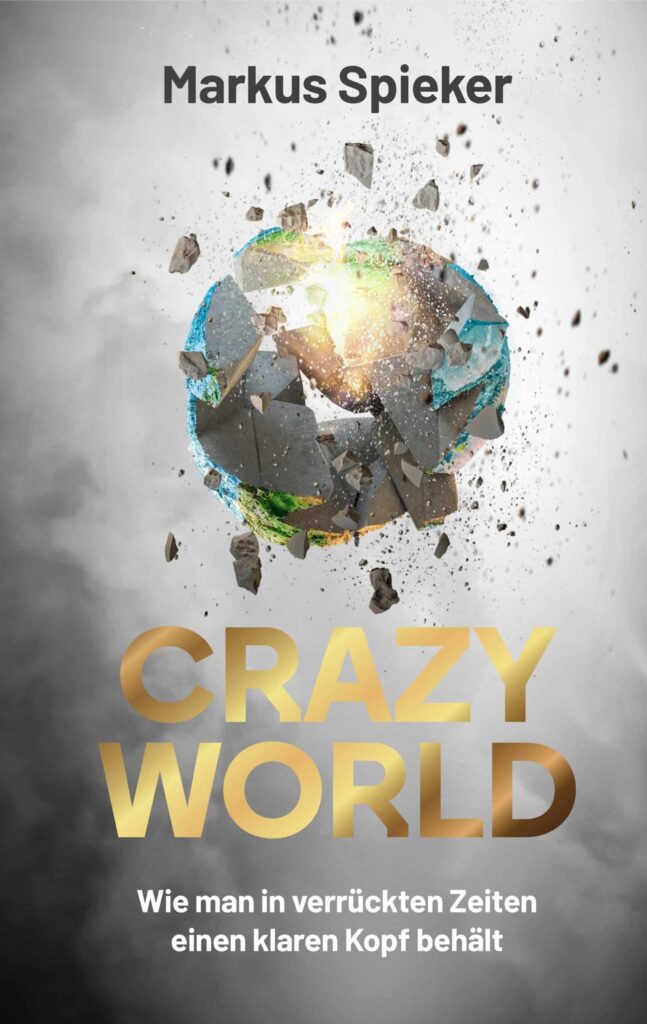 Foto: Fontis
Foto: FontisSie plädieren in Ihrem Buch für Tüchtigkeit. Für Patriotismus. Und auch für das Wiederentdecken von Traditionen. Warum sollte das alles den Zusammenhalt fördern?
Ich bin ein eher konservativer Zeitgenosse seit ich Teenager bin, und das spielt da sicher mit rein. Für mich ist Sozialkapital wichtig. Also vertrauensbasierte soziale Verhältnisse innerhalb einer Gesellschaft jenseits von Zwang und Verpflichtung. Das hilft nämlich in Krisenzeiten: Nachbarn, Kirchen, Vereine und so weiter. Die drei Klassiker Religionsgemeinschaft, Familie, Nation spielen dabei eine Rolle. Diese Einheiten helfen dabei, dass Menschen von ihren egoistischen Ansprüchen Abstand nehmen und sich um das Gemeinwohl kümmern. Das ist lange für viel zu selbstverständlich genommen worden. Als wären sie ein Automatismus. Nun merken wir, das ist nicht so und Individualismus und Diversität alleine machen eine Gesellschaft eben nicht stark. Und was die Tüchtigkeit angeht: Lasst uns feiern, wenn Menschen sich reinhängen und etwas erreichen. Es ist wie im Fußball: Das hilft dem ganzen Team. Und es schafft Aufbruchstimmung.
Wenn wir in die USA blicken und uns etwa die MAGA-Bewegung anschauen, dann plädiert sie für dieselben Prinzipien. Sogar für den christlichen Glauben. Aber Zusammenhalt fördert sie nicht.
Ja, der Sound von MAGA ist zu schrill und hochproblematisch. Ich wünschte mir einen gemäßigten Ansatz davon, kombiniert mit Menschenfreundlichkeit. Andererseits wünschte ich mir hier in Deutschland eine größere Offenheit, auch in diese Richtung zu denken. Debatten statt Moralisierung. Mehr zuhören, mehr diskutieren, Kämpfe führen, statt sie zu vermeiden. Man kennt das aus der Psychoanalyse: Die Probleme und Bedürfnisse, die man verdrängt, verschaffen sich dann oft in destruktiver Form Aufmerksamkeit. Und: Wer bestimmte Meinungen nicht anhört, dem geht auch ein Stück Realitätswahrnehmung verloren.
Wir brauchen das Gefühl des Zusammenarbeitens. Das kommt aber nicht auf, wenn 30 bis 40 Prozent sich nicht gehört oder gar delegitimiert fühlen. Die Lösung ist: Dialog, Dialog, Dialog. Das wäre eine Aufgabe auch für die Kirche, hier Debattenräume zu schaffen. Stattdessen wurden auch da schnell die Mauern hochgezogen. Ich verstehe das, bedaure es aber. Denn der Glaube ist doch ein Bindeglied über politische Haltungen hinweg. Nicht nur christliche Kirchen übrigens, auch an demokratischen Prinzipien ausgerichtete Moscheen können Trennung entgegenwirken. Wobei, historisch gesehen, Christen besonders erfolgreich darin sind, Menschen ganz unterschiedlicher Ethnien, Kulturen, Schichten miteinander zu verbinden.
„Nichts ist herrlicher als die Tatsache, dass Gott uns gemacht, sich in Jesus Christus offenbart hat und uns eine Ewigkeit in Freude verspricht. “
„Gute Absichten haben uns zukunftsblind gemacht“, schreiben Sie. Und: „Notwendig ist die Rückbesinnung auf das Reale, Notwendige und Machbare.“ Soll man denn gar nicht versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen?
Realistisch ist: Der Stärkere gewinnt. Aber das Korrektiv dazu ist die Liebe. Daher kommt die Fähigkeit des Menschen zur Zusammenarbeit. Ich kann keines der beiden Prinzipien negieren. Stärke und Effektivität sind derzeit in der Welt sehr wichtig, weil alles im Wandel ist. Dem entgegen steht diese Hippie-Idee von Freiheit und Liebe pur. Die ist toll, weil sie Vielfalt und Gemeinschaft bringt. Aber sie leidet unter einem Mangel an Struktur. Wir brauchen beides. Nachhaltigkeit ist politisch ein gutes Beispiel dafür. Wer nur die Welt verbessern will, ohne an die Effektivität zu denken, der wird nichts erreichen. Mittlerweile schreckt die deutsche Energiewende global gesehen eher ab, als sie für Klimaschutz wirbt. Und doch brauchen wir Nachhaltigkeit fürs Wohl der Gemeinschaft. Stärke und Liebe müssen zusammengehen.
Dein Buch hat 21 Kapitel. Was ist Ihnen das wichtigste?
Die letzten drei zu Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich komme in allen meinen Büchern, manche sagen zwanghaft, am Ende zum christlichen Glauben. Offenbar bin ich nicht in der Lage, das auszuklammern. Vermutlich wäre ich in punkto Verkaufszahlen erfolgreicher, wäre ich weniger fromm. Dennoch, es muss sein. Denn nichts ist herrlicher als die Tatsache, dass Gott uns gemacht, sich in Jesus Christus offenbart hat und uns eine Ewigkeit in Freude verspricht. Alles andere ist sekundär. Die Hoffnung ist das wichtigste Prinzip in dieser verrückten Welt.
Vielen Dank für das Gespräch!

