Vor genau zwei Jahren überfiel die Hamas Israel. In der Folge mordeten sich die Terroristen über Stunden durch israelische Kibbuzim im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Fast 1.200 Menschen wurden – teils bestialisch – ermordet. Mehr als 250 wurden entführt. Zum zweiten Jahrestag des Massakers befinden sich noch immer 48 Geiseln in den Händen der Hamas. In seinem Buch „Die Liebe zum Hass“ versucht der liberale Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi die Hintergründe des Massakers zu ergründen. Dabei gibt der Titel des Buchs bereits die Antwort, die die Leser an Golda Meir erinnert.
Denn die erste israelische Premierministerin antwortete einmal auf die Frage, wann es endlich Frieden zwischen Israelis und Palästinenser geben wird, mit dem Satz: „Frieden wird es geben, wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben, als sie Israel hassen.“ Meirs Regierungszeit liegt mittlerweile mehr als 50 Jahre zurück. Der Satz hat jedoch nicht an Aktualität eingebüßt, das belegt das Buch von Ourghi und nicht zuletzt das Massaker der Hamas.
Ourghi argumentiert, dass es im politischen Islam eine Kultur der Verachtung gegenüber Juden gebe. Diese „Liebe zum Hass“ mobilisiere nicht nur weltweit Muslime, sondern habe für viele zugleich ein sinnstiftendes Moment. In seinem Buch beschreibt der Wissenschaftler islamischen Antisemitismus als ein „kollektives Phänomen“. Aus seiner Sicht ist die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus in seiner Kollektivität und seiner sinnstiftenden Kultur des Hasses notwendig, um den 7. Oktober 2023 zu verstehen.
Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Ourghi mehrere Kapitel seines Buches dem Thema des islamischen Antisemitismus widmet. Das ist ebenso logisch wie hilfreich. Denn er erklärt nicht nur die Anfänge des Judenhasses im Islam, sondern thematisiert beispielsweise auch den adaptiven Sekundärantisemitismus – eine Form des Antisemitismus, die sich nach dem Holocaust entwickelt hat und sich neuen gesellschaftlichen und politischen Umständen anpasst, etwa durch Schuldabwehr, Relativierung der NS-Verbrechen oder die Verlagerung der Feindschaft auf Israel. Etwa, wenn Israelis als die neuen Nazis bezeichnet werden.
Aussöhnung ist möglich
Was zugegeben sehr technisch klingt, wird von Ourghi nicht nur verständlich erklärt, sondern hilft auch zu verstehen, warum sich der Hass auf Juden seit dem 7. Oktober teilweise völlig enthemmt auch auf deutschen und europäischen Straßen bahn bricht. Ourghi nennt das „atmosphärischen Antisemitismus“. Aus seiner Sicht wirkt „der 7. Oktober und seine Folgen“ – also Israels militärisches Vorgehen gegen die Hamas – als „Katalysator“ für die Verbreitung des islamischen Antisemitismus. Dazu warnt der Islamwissenschaftler: „Die Einstellungen der Muslime zu Juden und dem Staat Israel haben fatale Folge für die europäischen Staaten, in denen sie leben.“
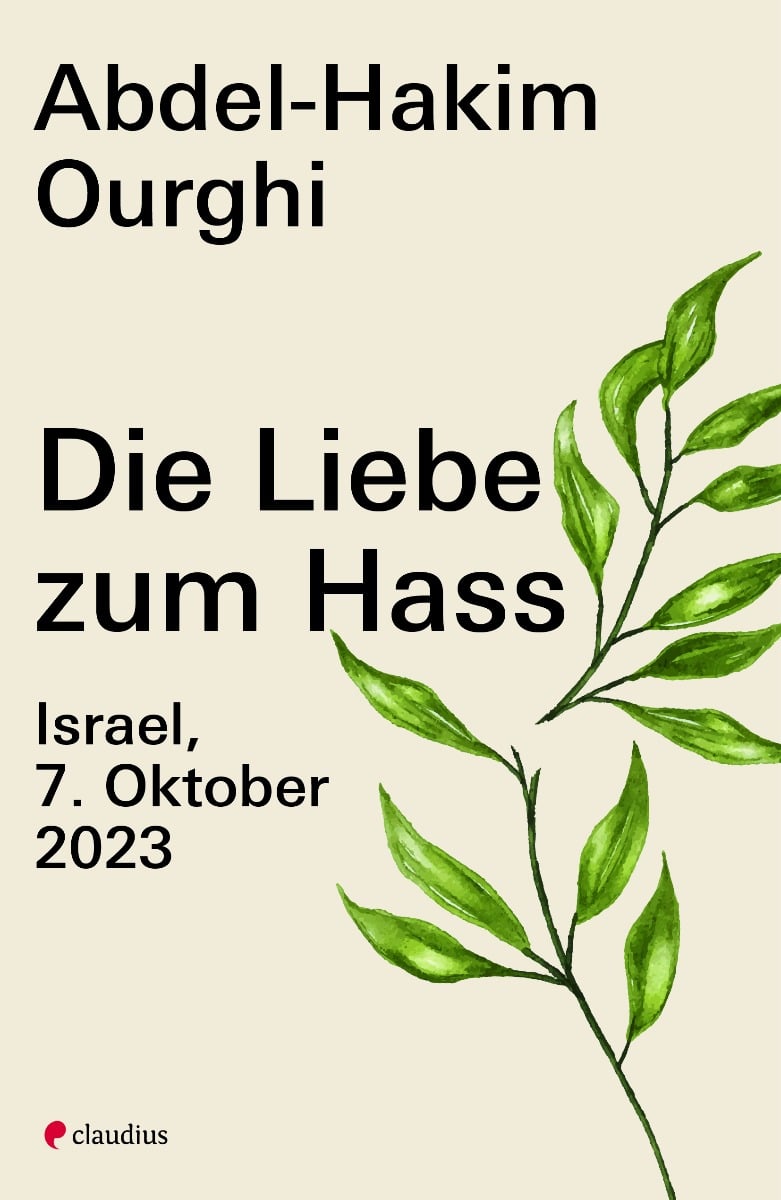 Foto: Claudius Verlag
Foto: Claudius Verlag Abdel-Hakim Ourghi, „Die Liebe zum Hass. Israel, 7. Oktober 2023“, Claudius, 223 Seiten, 24 Euro
Neben diesen ausführlichen, aber lohnenden und mit Beispielen anschaulich gemachten Erklärungen zu den verschiedenen Spielarten des Antisemitismus, wirft Ourghi aber auch einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Das mag bei einem solchen Thema zunächst verwundern, scheint aber angesichts des überbordenden Hasses dringend notwendig zu sein. Zwar betont der Autor, dass die Ideologie der Hamas militärisch nicht zu besiegen sei. Es sei aber sehr wohl möglich, gegen Hass und Verachtung anzugehen und diese durch konstruktive politische, wirtschaftliche und soziale Alternativen einzudämmen.
Für ein dauerhaftes friedliches Zusammenleben brauche es jedoch einen „umfassenden Heilungsprozess“. Voraussetzung dafür sei Kommunikation miteinander, denn „jeder Dialog kann dazu beitragen, die Macht des Bösen zu verkleinern“. Ourghi argumentiert an dieser Stelle keineswegs mit dem Prinzip Hoffnung. Da in muslimischen Kulturen der Glaube an Autoritäten eine große Rolle spiele, müssten diese eingebunden werden. Dabei dürfte er auch die Abraham-Abkommen im Blick haben, die arabische Herrscher trotz innenpolitischer Kritik mit Israel geschlossen haben. Zudem fordert Ourghi mit Blick auf Deutschland, die „im Rahmen des Rechtsstaats zur Verfügung stehenden Machtmittel auch entschlossen“ anzuwenden. In die Pflicht nimmt der Islamwissenschaftler auch Muslime selbst. „Der islamische Antisemitismus ist auch das Produkt einer unaufgeklärten Geschichte des Islam.“ Deswegen sei ein „Selbstaufklärungsprozess“, der mit einer kritischen Auseinandersetzung des 7. Oktober beginnen könnte, notwendig. Zudem plädiert Ourghi im Buch für eine Allianz zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Liberalen, um den politischen Islam einzudämmen.
Darüber hinaus nennt Ourghi den Prozess der unwahrscheinlichen Aussöhnung zwischen Deutschland und Israel nach den Schrecken des Holocaust als ein Beispiel dafür, dass aus Hass, Tod und Trauer wieder etwas Gutes entstehen kann. Oder mit den Worten eines weiteren israelischen Premiers gesprochen: „Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.“ (David Ben-Gurion).

