pro: Sie gehören beide zur sogenannten Generation Y, den zwischen 1980 und dem Jahr 2000 Geborenen. In einem Satz: Was glauben Sie?
Stephanie Schwenkenbecher: Ich glaube, Gott ist die Liebe, und das ist, was zählt.
Leitlein: (überlegt lange) Irgendwas zwischen Vertrauen, Gehaltensein, Aufbäumen, Niederknien, verloren und gefunden sein.
Die Frage nach dem Glauben haben Sie 24- bis 36-Jährigen für Ihr Buch gestellt. Was waren die überraschendsten Antworten?
Schwenkenbecher: ‚Wir sind Sternenstaub‘ fand ich am schönsten. Die Leute haben eigentlich recht stereotyp geantwortet. Sie haben das Glaubensbekenntnis zitiert, wie wir es jeden Sonntag in der Kirche sprechen. Das finde ich einerseits gut, weil die alten Texte stark sind und eine lange Tradition haben. Dennoch fand ich es frappierend, dass so wenige in der Lage sind, eigene Worte zu finden.
Leitlein: Mich hat überrascht, dass das Gottesbild eines alten Mannes mit Bart noch so präsent ist. Es zieht sich durch fast alle Antworten. Ich dachte, wir hätten das hinter uns gelassen. Einer sagte, Gott sei für ihn wie Gandalf aus „Herr der Ringe“.
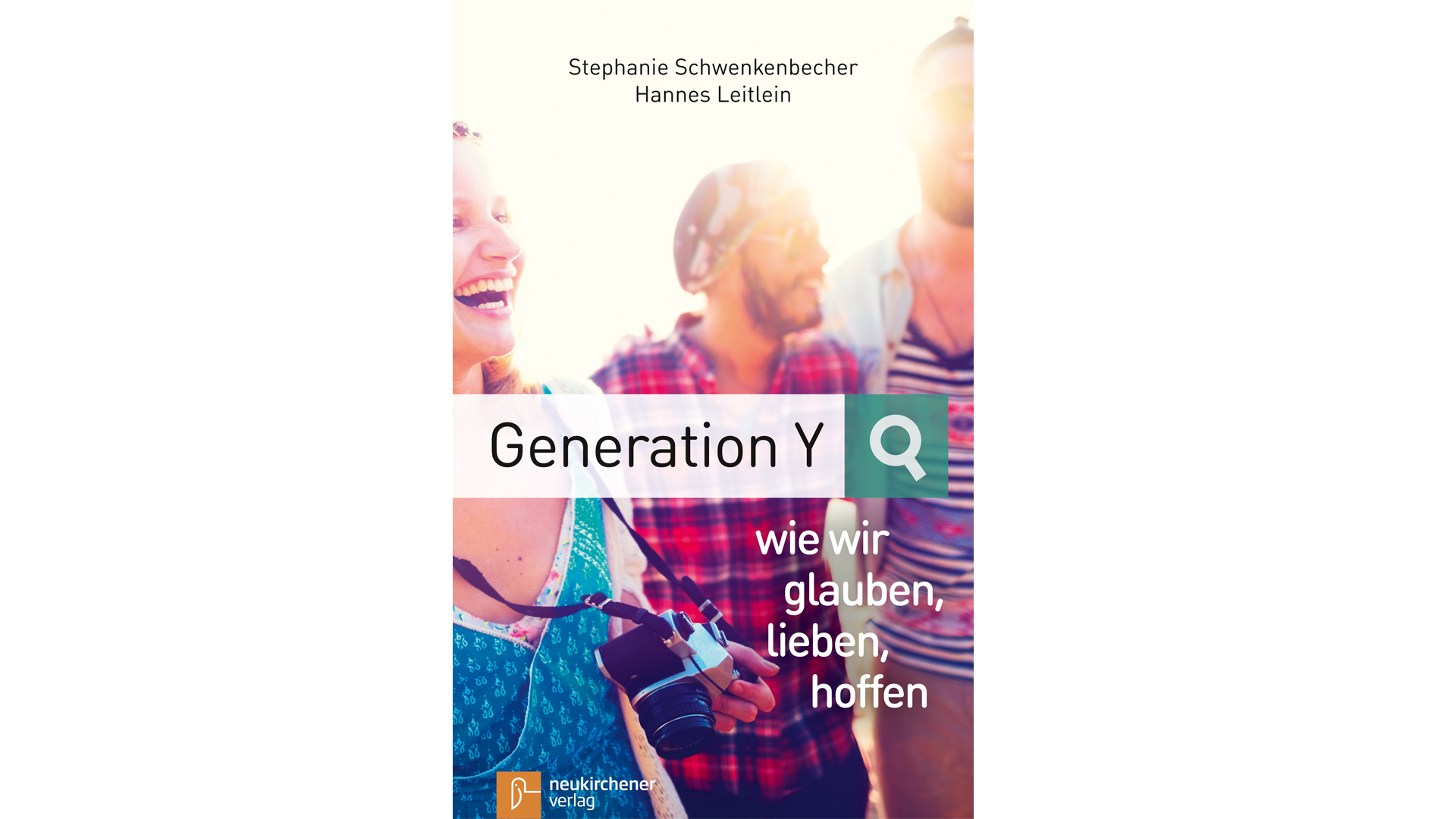
Was unterscheidet die Gläubigen der Generation Y von denen davor?
Leitlein: Es ist sehr schwierig, Aussagen über die sogenannte Generation Y als ein Ganzes zu treffen. Einen Mitte-Zwanzigjährigen unterscheidet viel von einem Mitte-Dreißigjährigen. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten. Der 11. September ist für die allermeisten von uns ein prägendes Erlebnis. Wir haben damals erlebt, wie ein Glaube politisch instrumentalisiert wurde. Sowohl junge Christen als auch Muslime müssen bis heute damit umgehen.
Schwenkenbecher: Da, wo Christen sich heute vernetzen, geschieht das immer in einer gewissen Ökumene. Das ist nahezu selbstverständlich geworden. Auch der Umgang mit Moral hat sich geändert. Wir verurteilen weniger schnell. Das ist uns auch bei Konservativen aufgefallen. Einer unserer Porträtpartner sagte: ‚Es kann sein, dass ich in zwanzig Jahren anders darüber denke.‘ Diese Einstellung empfand ich bei allen, mit denen wir gesprochen haben, als sehr präsent.
Woher kommt es, dass sich junge Menschen weniger festlegen?
Leitlein: Wenn ich nicht mehr so genau weiß, was Christsein oder meine Konfession ausmacht, dann vertrete ich das auch nicht mehr allzu vehement. Die große Flexibilität, die unserer Generation im Alltag abverlangt wird, schlägt sich auch im Glaubensleben nieder. Heute sind die Dinge weniger absolut.
Schwenkenbecher: Alle, mit denen wir gesprochen haben, waren auf dem Weg: neu an der Arbeitsstelle, im Umzug, auf der Suche nach einer Gemeinde oder nur punktuell im Gottesdienst. In einem neuen Umfeld stellt man sich vielleicht eher die Frage, was überhaupt wichtig ist und anderes tritt in den Hintergrund. Was mir aber auch klar geworden ist: Es gibt viele ernsthaft gläubige Menschen in der Generation Y. Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, hatten größtenteils ein sehr tiefes Verhältnis zu Kirche und Glauben.
Leitlein: Ja. Wir erleben keine Krise des Glaubens, sondern eine Krise der Institution …
… deshalb beschreiben Sie die Volkskirchen in Ihrem Buch als „verhimmelt“, also weit entfernt von den Menschen, um die sie sich eigentlich kümmern sollen. Wo erleben Sie das?
Schwenkenbecher: Es gibt zwei Möglichkeiten, auf den Bruch der Menschen mit Religion zu reagieren. Die erste ist: Man igelt sich ein und sagt, so, wie wir es immer gemacht haben, ist es gut. Die zweite ist: Man überlegt, wer verloren geht, warum und wie dieses Problem zu lösen ist. Das machen Bewegungen wie FreshX oder die Emerging Church. Sie gehen raus und suchen neue Formen – und die haben es nicht immer leicht, in der Volkskirche ein Dach zu finden.
Leitlein: In unserem Kiez gibt es eine wunderschöne Kirche mit einem großen Platz davor, der abends immer voll ist. Die Leute sitzen da, trinken ihr Bier, unterhalten sich. Aber es gibt keinen Verknüpfungspunkt mit der Kirchgemeinde. Das ist für mich ein Bild für die gesamte Kirche: Es tut ihr immer noch nicht weh genug, dass die Menschen nichts mit ihr zu tun haben wollen. Ein Beispiel: In vielen Kirchengemeinden sind die oft abendlichen Jugendgottesdienste viel besser besucht und lebendiger als die am Sonntagmorgen. Trotzdem bestehen Trennungen zwischen Haupt- und Jugendgemeinde fort. Warum macht die Kirchenleitung in einem solchen Fall nicht die Jugendgemeinde zur Hauptgemeinde und stattet sie mit mehr Budget aus? Große Unternehmen bilden heutzutage innerhalb des Konzerns unabhängige Startups, um neue Zielgruppen zu erschließen. Ich verstehe nicht, warum die Kirche noch kein Startup hat.
Ist das in Freikirchen genauso?
Schwenkenbecher: Wir vermuten, dass das eher ein Generationenproblem ist als eines, das sich an Denominationen oder Konfessionen fest macht. Wo Gemeinden älter werden, entstehen diese Probleme.
Sie stellen im Buch fest: „Wir gehen auf das Ende der Volkskirchen zu.“ Was kommt danach?
Schwenkenbecher: Ich glaube nicht, dass wir in unserer Lebenszeit das Ende der Volkskirchen sehen. Und ich habe auch noch Hoffnung, dass sie sich wandelt. Andererseits finde ich es wichtig, Christen zu bevollmächtigen. Ein Pastor ist nicht die Kirche. Wenn Gläubige Bibelwissen haben, Hauskreise gründen, gemeinsam beten und sich vernetzen, dann ist das Gemeinde. Das ist für mich die Zukunft.
Leitlein: Ich wünsche mir von der Kirche, dass sie nicht länger so tut, als wäre sie noch die alte. Das pompöse Reformationsjubiläum ist ein Ausdruck dieser puren Ignoranz, die nicht sehen will, dass schon längst alles anders ist, weil Tausende der Kirche verloren gegangen sind. Und ich wünsche mir, dass sie wahrnimmt, dass es Menschen gibt, die sich engagieren und denen es nicht egal ist, was aus der Kirche wird. Die sollte sie ausstatten. Damit meine ich, ihnen nicht nur über den Kopf zu streicheln und zu sagen: ‘schöner Jugendgottesdienst’. Sondern ihnen ein fettes Budget zu geben, bei der Verwaltung zu helfen und sie zu begleiten.
Sie stellen in Ihrem Buch neue Gemeindeformen vor, Lebensgemeinschaften zum Beispiel oder Kollektive. Hat sich mit der Form der Gemeinden auch die Theologie verändert?
Leitlein: Es gibt Gemeinden, die eine sehr moderne Anmutung haben mit Band, Lichtshow und so weiter, die im Kern aber sehr restriktiv, ja geradezu reaktionär sind. Am Ende predigen dann da nur Männer und Sex vor der Ehe ist verboten. Dann gibt es die andere Seite, sehr liberale Gemeinden, die eine althergebrachte Form haben. Und dann gibt es Gemeinden, die diesen Spagat hinbekommen, einerseits von der Form her anschlussfähig zu sein und zugleich die richtigen Fragen zu stellen. Zum Beispiel: ‚Wie läuft es in eurer Beziehung?‘ statt: ‚Wart ihr vor eurer Ehe im Bett?‘ Ich sehe eine Veränderung zu letzterem und hoffe auch, dass sich das durchsetzt.
Jemandem wie dem Prediger Ulrich Parzany dürfte das nicht gefallen, der würde kontern, die Kirche braucht eine klare biblische Moral, sonst wird sie obsolet.
Schwenkenbecher: Glauben ist ein Beziehungsgeschehen. Jesus Christus ist eine Person. Deshalb können wir die Bibel nicht aufschlagen und sagen: ‚Regel eins und Regel zwei befolgt, fertig‘. Wir müssen den Einzelnen sehen. Es geht nicht darum, die Regel einzuhalten, sondern darum zu erkennen, wofür eine Regel gut ist. Das verlieren wir oft aus dem Fokus.
Leitlein: Ulrich Parzany ist ein fleißiger Theologe, der die Bibel viel besser kennt als ich. Wir sind hin und wieder im Gespräch und in Manchem sogar einig. Dennoch konnte er mich bisher nicht überzeugen, dass es ihm um den einzelnen Menschen geht und nicht doch bloß um Rechthaberei. Seine starre Position ist unserer Generation nicht mehr zu vermitteln. Wo genau in der Bibel steht, dass ein Mann nicht bei einem Mann liegen darf, interessiert junge Menschen heute eben nur noch, wenn ihnen auch plausibel gemacht werden kann, warum Liebe nicht gleich Liebe sein soll. Ich verstehe nicht, wohin dieser Kampf führen soll.
Vermutlich würden konservative Christen darauf antworten, dass sie den Menschen helfen wollen, indem sie sie vor Sünde bewahren. Nächstenliebe statt Rechthaberei also.
Leitlein: Dieses Engagement sehe ich aber nicht. In welcher evangelikalen Gemeinde werden denn Menschen, die sich scheiden lassen, aufgefangen? Stattdessen werden sie verstoßen …
Schwenkenbecher: … oder gehen, weil sie sich dem Anspruch nicht gewachsen sehen.
Sie plädieren in Ihrem Buch nicht nur für einen neuen Umgang mit Moral in den Kirchen, sondern auch für mehr Vielfalt. Wieviel Vielfalt kann eine Gemeinde aushalten?
Leitlein: Im Reich Gottes gibt es keine Obergrenze. Kirche verändert sich. Die erste Gemeinde hatte täglich Zulauf von Hunderten und hat das ausgehalten. Meistens fehlt ja gerade diese Vielfalt.
Schwenkenbecher: In Beziehung und im Gespräch lässt sich das meiste klären. Das erlebe ich in meiner Gemeinde und daran glaube ich.
Vielen Dank für das Gespräch!
Was unterscheidet die Gläubigen der Generation Y von denen davor?
Leitlein: Es ist sehr schwierig, Aussagen über die sogenannte Generation Y als ein Ganzes zu treffen. Einen Mitte-Zwanzigjährigen unterscheidet viel von einem Mitte-Dreißigjährigen. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten. Der 11. September ist für die allermeisten von uns ein prägendes Erlebnis. Wir haben damals erlebt, wie ein Glaube politisch instrumentalisiert wurde. Sowohl junge Christen als auch Muslime müssen bis heute damit umgehen.
Schwenkenbecher: Da, wo Christen sich heute vernetzen, geschieht das immer in einer gewissen Ökumene. Das ist nahezu selbstverständlich geworden. Auch der Umgang mit Moral hat sich geändert. Wir verurteilen weniger schnell. Das ist uns auch bei Konservativen aufgefallen. Einer unserer Porträtpartner sagte: ‚Es kann sein, dass ich in zwanzig Jahren anders darüber denke.‘ Diese Einstellung empfand ich bei allen, mit denen wir gesprochen haben, als sehr präsent.
Woher kommt es, dass sich junge Menschen weniger festlegen?
Leitlein: Wenn ich nicht mehr so genau weiß, was Christsein oder meine Konfession ausmacht, dann vertrete ich das auch nicht mehr allzu vehement. Die große Flexibilität, die unserer Generation im Alltag abverlangt wird, schlägt sich auch im Glaubensleben nieder. Heute sind die Dinge weniger absolut.
Schwenkenbecher: Alle, mit denen wir gesprochen haben, waren auf dem Weg: neu an der Arbeitsstelle, im Umzug, auf der Suche nach einer Gemeinde oder nur punktuell im Gottesdienst. In einem neuen Umfeld stellt man sich vielleicht eher die Frage, was überhaupt wichtig ist und anderes tritt in den Hintergrund. Was mir aber auch klar geworden ist: Es gibt viele ernsthaft gläubige Menschen in der Generation Y. Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, hatten größtenteils ein sehr tiefes Verhältnis zu Kirche und Glauben.
Leitlein: Ja. Wir erleben keine Krise des Glaubens, sondern eine Krise der Institution …
… deshalb beschreiben Sie die Volkskirchen in Ihrem Buch als „verhimmelt“, also weit entfernt von den Menschen, um die sie sich eigentlich kümmern sollen. Wo erleben Sie das?
Schwenkenbecher: Es gibt zwei Möglichkeiten, auf den Bruch der Menschen mit Religion zu reagieren. Die erste ist: Man igelt sich ein und sagt, so, wie wir es immer gemacht haben, ist es gut. Die zweite ist: Man überlegt, wer verloren geht, warum und wie dieses Problem zu lösen ist. Das machen Bewegungen wie FreshX oder die Emerging Church. Sie gehen raus und suchen neue Formen – und die haben es nicht immer leicht, in der Volkskirche ein Dach zu finden.
Leitlein: In unserem Kiez gibt es eine wunderschöne Kirche mit einem großen Platz davor, der abends immer voll ist. Die Leute sitzen da, trinken ihr Bier, unterhalten sich. Aber es gibt keinen Verknüpfungspunkt mit der Kirchgemeinde. Das ist für mich ein Bild für die gesamte Kirche: Es tut ihr immer noch nicht weh genug, dass die Menschen nichts mit ihr zu tun haben wollen. Ein Beispiel: In vielen Kirchengemeinden sind die oft abendlichen Jugendgottesdienste viel besser besucht und lebendiger als die am Sonntagmorgen. Trotzdem bestehen Trennungen zwischen Haupt- und Jugendgemeinde fort. Warum macht die Kirchenleitung in einem solchen Fall nicht die Jugendgemeinde zur Hauptgemeinde und stattet sie mit mehr Budget aus? Große Unternehmen bilden heutzutage innerhalb des Konzerns unabhängige Startups, um neue Zielgruppen zu erschließen. Ich verstehe nicht, warum die Kirche noch kein Startup hat.
Ist das in Freikirchen genauso?
Schwenkenbecher: Wir vermuten, dass das eher ein Generationenproblem ist als eines, das sich an Denominationen oder Konfessionen fest macht. Wo Gemeinden älter werden, entstehen diese Probleme.
Sie stellen im Buch fest: „Wir gehen auf das Ende der Volkskirchen zu.“ Was kommt danach?
Schwenkenbecher: Ich glaube nicht, dass wir in unserer Lebenszeit das Ende der Volkskirchen sehen. Und ich habe auch noch Hoffnung, dass sie sich wandelt. Andererseits finde ich es wichtig, Christen zu bevollmächtigen. Ein Pastor ist nicht die Kirche. Wenn Gläubige Bibelwissen haben, Hauskreise gründen, gemeinsam beten und sich vernetzen, dann ist das Gemeinde. Das ist für mich die Zukunft.
Leitlein: Ich wünsche mir von der Kirche, dass sie nicht länger so tut, als wäre sie noch die alte. Das pompöse Reformationsjubiläum ist ein Ausdruck dieser puren Ignoranz, die nicht sehen will, dass schon längst alles anders ist, weil Tausende der Kirche verloren gegangen sind. Und ich wünsche mir, dass sie wahrnimmt, dass es Menschen gibt, die sich engagieren und denen es nicht egal ist, was aus der Kirche wird. Die sollte sie ausstatten. Damit meine ich, ihnen nicht nur über den Kopf zu streicheln und zu sagen: ‘schöner Jugendgottesdienst’. Sondern ihnen ein fettes Budget zu geben, bei der Verwaltung zu helfen und sie zu begleiten.
Sie stellen in Ihrem Buch neue Gemeindeformen vor, Lebensgemeinschaften zum Beispiel oder Kollektive. Hat sich mit der Form der Gemeinden auch die Theologie verändert?
Leitlein: Es gibt Gemeinden, die eine sehr moderne Anmutung haben mit Band, Lichtshow und so weiter, die im Kern aber sehr restriktiv, ja geradezu reaktionär sind. Am Ende predigen dann da nur Männer und Sex vor der Ehe ist verboten. Dann gibt es die andere Seite, sehr liberale Gemeinden, die eine althergebrachte Form haben. Und dann gibt es Gemeinden, die diesen Spagat hinbekommen, einerseits von der Form her anschlussfähig zu sein und zugleich die richtigen Fragen zu stellen. Zum Beispiel: ‚Wie läuft es in eurer Beziehung?‘ statt: ‚Wart ihr vor eurer Ehe im Bett?‘ Ich sehe eine Veränderung zu letzterem und hoffe auch, dass sich das durchsetzt.
Jemandem wie dem Prediger Ulrich Parzany dürfte das nicht gefallen, der würde kontern, die Kirche braucht eine klare biblische Moral, sonst wird sie obsolet.
Schwenkenbecher: Glauben ist ein Beziehungsgeschehen. Jesus Christus ist eine Person. Deshalb können wir die Bibel nicht aufschlagen und sagen: ‚Regel eins und Regel zwei befolgt, fertig‘. Wir müssen den Einzelnen sehen. Es geht nicht darum, die Regel einzuhalten, sondern darum zu erkennen, wofür eine Regel gut ist. Das verlieren wir oft aus dem Fokus.
Leitlein: Ulrich Parzany ist ein fleißiger Theologe, der die Bibel viel besser kennt als ich. Wir sind hin und wieder im Gespräch und in Manchem sogar einig. Dennoch konnte er mich bisher nicht überzeugen, dass es ihm um den einzelnen Menschen geht und nicht doch bloß um Rechthaberei. Seine starre Position ist unserer Generation nicht mehr zu vermitteln. Wo genau in der Bibel steht, dass ein Mann nicht bei einem Mann liegen darf, interessiert junge Menschen heute eben nur noch, wenn ihnen auch plausibel gemacht werden kann, warum Liebe nicht gleich Liebe sein soll. Ich verstehe nicht, wohin dieser Kampf führen soll.
Vermutlich würden konservative Christen darauf antworten, dass sie den Menschen helfen wollen, indem sie sie vor Sünde bewahren. Nächstenliebe statt Rechthaberei also.
Leitlein: Dieses Engagement sehe ich aber nicht. In welcher evangelikalen Gemeinde werden denn Menschen, die sich scheiden lassen, aufgefangen? Stattdessen werden sie verstoßen …
Schwenkenbecher: … oder gehen, weil sie sich dem Anspruch nicht gewachsen sehen.
Sie plädieren in Ihrem Buch nicht nur für einen neuen Umgang mit Moral in den Kirchen, sondern auch für mehr Vielfalt. Wieviel Vielfalt kann eine Gemeinde aushalten?
Leitlein: Im Reich Gottes gibt es keine Obergrenze. Kirche verändert sich. Die erste Gemeinde hatte täglich Zulauf von Hunderten und hat das ausgehalten. Meistens fehlt ja gerade diese Vielfalt.
Schwenkenbecher: In Beziehung und im Gespräch lässt sich das meiste klären. Das erlebe ich in meiner Gemeinde und daran glaube ich.
Vielen Dank für das Gespräch!
Die Fragen stellte Anna Lutz.


