Die Brüdergemeinde hätte es vertuscht. Die hätte das unter den Teppich gekehrt“, sagt Detlev Zander zu Beginn des Films „Die Kinder aus Korntal“. Mit „das“ meint er den hundertfachen Missbrauch an Kindern in den Heimen der pietistisch geprägten Einrichtungen in den 50er bis 70er Jahren. Sexualisierte Gewalt. Erniedrigungen. Schwarze Pädagogik. Arbeitszwang. „Wir waren Menschenmüll. Wir waren nichts wert“, erinnert er sich in der Dokumentation aus dem Jahr 2024.
Ein Jahr später. PRO trifft Zander zum Gespräch. Es soll darum gehen, wie sein Leid und das der vielen anderen Betroffenen in Korntal und anderswo, so aufgearbeitet werden kann, dass Verantwortliche, heutige Mitarbeitende und Opfer ins Gespräch kommen. In ein Miteinander. Kann Aufarbeitung überhaupt funktionieren? Und wenn ja, wie? Was wünschen sich Betroffene und was sind die Institutionen, in denen die Taten geschahen, in der Lage, zu leisten?
Zander, jener Mann, der einst als Junge von einem Betreuer in einem Fahrradkeller gefesselt und sexuell missbraucht wurde und später immer wieder sexualisierte Gewalt erfuhr, ist nicht wütend. Er hat seine Geschichte schon dutzende Male öffentlich erzählt. Doch das ist nicht der Grund für seine Gefasstheit. Zwölf Jahre sind vergangen, seit er die Verbrechen in Korntal öffentlich gemacht und damit einen Skandal aufgedeckt hat. Zwölf Jahre, in denen Zander angeklagt, gekämpft, sich aufgebäumt und Gerechtigkeit gefordert hat. „Ich wollte die Institution zerstören“, sagt er, wenn er zurückblickt. Doch an diesem Tag im Jahr 2025 findet er fast schon sanfte Worte: Korntal habe eine „unheimlich steile Lernkurve gemacht“. Zander lobt ein „ehrliches und offenes Miteinander“. „Ich war ihr größter Feind, aber heute arbeiten wir zusammen“, sagt er.

Sollte also ausgerechnet Korntal nun ein Beispiel für gelungene Aufarbeitung sein – jene Gemeinde und diakonische Einrichtung, die noch vor einem Jahr in den Schlagzeilen stand, weil sie sich gegen eine Dokumentation wehrte, die das Leid der Betroffenen zeigte und faire Entschädigungen forderte?
Um das zu klären, muss zunächst deutlich sein, worum es hier geht. Institutionelle Aufarbeitung, so steht es in den jüngst erschienen Standards zur Betroffenenbeteiligung, herausgegeben von der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM), meint die „strukturierte Auseinandersetzung einer Institution (…) mit Fällen sexualisierter Gewalt in ihren Reihen“. Das Ziel: „Dass die Institution und ihre Mitarbeitenden Verantwortung übernehmen, Lehren ziehen, Strukturen verändern und bessere Mechanismen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen implementieren.“ Der Blick in die Vergangenheit und der Blick in die Zukunft gehören also zusammen. Wer die Verbrechen der Vergangenheit nicht anschaut, kann sie auch künftig nicht verhindern.
Julia Gebrande ist Vorsitzende der Unabhängigen Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Für sie ist klar: „Viele Institutionen tun sich sehr schwer mit diesem Thema und wissen nicht, wie Aufarbeitung gut umgesetzt werden kann.“ Man wolle nicht mit dem Thema Missbrauch in Verbindung gebracht werden, scheue den Imageverlust. Doch sie rät Kirchen, Vereinen und anderen Organisationen zum Gegenteil: „Es ist besser, das Thema proaktiv anzugehen. Das kann verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen.“
Was sollte eine Einrichtung also konkret tun, sobald ein Fall von sexualisierter Gewalt bekannt wird? Der erste Schritt, so erklärt sie, sei die Intervention: Betroffene schützen, bestenfalls mit Hilfe der Fachberatungsstellen vor Ort. Signale dokumentieren, Ruhe bewahren und sich im Team und mit Unterstützern organisieren. Wenn die akute Gefahr gebannt sei, beginne die Aufarbeitung. Dabei sei es ganz egal, ob es sich um einen Einzelfall oder mehrere Fälle handele oder gar ein systemisches Problem bekannt würde. Dazu gehörten Fragen wie: Welche Strukturen haben es ermöglicht, dass Missbrauch stattfinden konnte? Das sei der Beginn von Prävention. „Jede Institution sollte die Beratungsstellen vor Ort kennen und mit ihnen in Kooperation stehen. Auch, um ein Schutzkonzept zu entwickeln. Egal, ob bereits etwas vorgefallen ist oder nicht“, sagt Gebrande. Vor allem das Hinzuziehen externer Beratung falle Institutionen schwer. Insbesondere den Kirchen. „Das Teilen von Macht ist ein Problem“, sagt sie. Etwa wegen teils starker Hierarchien im gemeindlichen Kontext. Hinzu komme „ein Glaubenssystem mit starken moralischen Vorstellungen und einer Tabuisierung der Sexualität über viele Jahrhunderte hinweg“.
Prozess mit Rückschlägen
Eine Frau, die sich besonders mit Missbrauchsfällen im kirchlichen Kontext auskennt, ist die Journalistin Christiane Florin. Seit 15 Jahren berichtet sie über das Thema, zuletzt erschien ihr Buch „Keinzelfall“, in dem sie nicht nur die brutale Geschichte eines ehemaligen Heimkindes erzählt. Sondern auch davon berichtet, wie die zuständige Institution, eine Einrichtung der Caritas, schleppend und unwillig aufarbeitet. „Nichts von der institutionellen Schuldgeschichte wäre bekannt, wenn nicht Betroffene davon erzählt hätten“, sagt sie über kirchliche Missbrauchsfälle. „Institutionen sind nicht proaktiv, obwohl sie wissen, dass sie eine Schuldgeschichte haben. Der Anstoß kommt immer von Betroffenen.“
Nach wie vor gebe es „Frontstellungen“ zwischen Betroffenen und Institutionen, anstatt dass zusammengearbeitet werde. Nach wie vor scheuten insbesondere Kirchen sich, unabhängig aufarbeiten zu lassen, und wollten das Heft in der Hand behalten. Nach wie vor kämen Informationen nur scheibchenweise ans Licht. „Aufarbeitung ist nicht gewollt“, sagt sie und klingt bitter. Oft werde sie bei Vorträgen in Kirchen gefragt, wie sie es aushalte, sich so lange und so häufig mit Missbrauchsfällen zu beschäftigen. Sie frage dann zurück: „Wie halten Sie es aus, sich nicht damit zu beschäftigen?“ Vorbei sein müsse es mit der Mär: „Bei uns gibt es das nicht.“
Einen Unwillen zur Aufarbeitung warfen wohl die wenigsten Korntal vor. Die Probleme zeigten sich hier auf ganz andere Weise. Im Jahr 2014 begannen Brüdergemeinde und Diakonie die systematische institutionelle Aufklärung. Mit erheblichen Rückschlägen. Zwar wurde mit der Sozialwissenschaftlerin Mechthild Wolff eine unabhängige Aufklärerin hinzugezogen. Die jedoch zog sich mitten im Prozess zurück, beklagte mangelndes Vertrauen vonseiten der Betroffenen. Diese erklärten, sie würden zu wenig beteiligt, und sahen sich getroffen durch Widerstände gegen die Aufklärung, die es in der Gemeinde auch gab. Der erste Anlauf endete 2016 und hinterließ tiefe Gräben.
Die Forum-Studie
Die Forum Studie erschien 2024 und dokumentiert im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erstmals umfassend und unabhängig das Ausmaß und Gründe für sexualisierte Gewalt innerhalb der evangelischen Kirche. Die Forscher schreiben darin von 1.259 Beschuldigten und mindestens 2.225 Betroffenen, betonen aber, dass dies nur als „Spitze des Eisbergs“ zu verstehen sei. Neben den Zahlen offenbart die Studie vor allem spezifisch evangelische Probleme bei der Aufklärung und Aufarbeitung von Missbrauchsfällen wie: „Harmoniezwang, diffuse Beziehungsgestaltung, unklares Sexualitätsverständnis, Umgang mit Schuld, Exklusion Betroffener“. Zentral sind auch die Handlungsempfehlungen der Studie, etwa, dass kirchliche Einrichtungen in der Verantwortung stehen, Gewalt aufzuarbeiten – und zwar unabhängig davon, ob Betroffene sie dazu auffordern oder nicht. Die Studie empfiehlt Einrichtungen zudem etwa, externe Hilfe hinzuzuziehen, Mitarbeiter umfassend zu Aufarbeitung und sexualisierter Gewalt zu schulen und in jedem Fall betroffenenorientiert zu arbeiten.
Noch im selben Jahr versuchte Korntal es wieder. Neue Aufklärer wurden engagiert, ein Schuldbekenntnis formuliert. Im Juni 2018 erschien ein über 400 Seiten dicker Aufklärungsbericht. Auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung kam es trotzdem erneut zum Eklat. Ausgerechnet Detlev Zander ist es damals, der aus den Zuschauerreihen heraus harte Kritik übt. Die Befragungen durch die Aufklärer hätten die Betroffenen retraumatisiert. Er selbst sehe sich aus dem Prozess „rausgeekelt“. Neun Jahre später blickt er gegenüber PRO zurück: Die Brüdergemeinde habe die Deutungshoheit über den Prozess gehabt, Betroffene seien zu wenig beteiligt gewesen und im Vordergrund habe der Schutz der Institution gestanden, so sein Urteil. Von der Aufklärerin, der ehemaligen Richterin Brigitte Baums-Stammberger, habe er sich „verhört“ statt angehört gefühlt. Neun Stunden lang habe sie versucht, herauszufinden, ob er lüge. Bei aller Kritik: Der Aufarbeitungsbericht von 2018 gilt im deutschlandweiten Kontext als bahnbrechend. Aufarbeitung war damals zwar kein Neuland, Standards zur Betroffenenbeteiligung aber gab es nicht, ebenso wenig wie breit gestreute Fach- oder Beratungsstellen. Dennoch: Große Zufriedenheit bei den Betroffenen löste auch der zweite Prozess nicht aus. Wieder gab es Kritik, Unzufriedenheit, Verletzungen.
Film mit Sprengkraft
Sechs Jahre später knallt es erneut und zwar heftig. 2024 erscheint der Film „Die Kinder aus Korntal“ von Julia Charakter. Darin kommen sechs Betroffene zu Wort, die ihr Leid und auch ihr Hadern mit einer mangelnden Aufarbeitung und Entschädigung durch Korntal schildern. Unter ihnen auch Zander. Der Film zeigt auch Menschen aus der Gemeinde, die darum bitten, dass die ständige Beschäftigung mit der Vergangenheit doch endlich enden müsse. Er ist ein Zeitdokument und ein Beleg der Verletzungen, die in Korntal geschehen sind. Er fokussiert sich auf die Betroffenenperspektive. Und ist emotional kaum auszuhalten. Korntal reagiert verärgert auf die Produktion. In einer breiten Stellungnahme werfen Gemeinde und Diakonie den Machern vor, den Aufarbeitungsprozess und mühsam erreichten Dialog zu behindern. Man wünsche sich einen zweiten Teil, „der dem Anspruch einer faktenbasierten Dokumentation gerecht wird“. „Ich war stinksauer, als ich das gelesen habe“, sagt Zander.
Ein Jahr ist seitdem vergangen. PRO hat auch Korntal um ein Gespräch gebeten. Mit vornehmlich einer Frage: Ist die Aufarbeitung dort gelungen? Trotz all der Rückschläge, der Kritik, den Streitigkeiten? „Gelungen“, das sei der falsche Begriff. Denn immerhin gehe es um tiefes Leid, da könne nichts gelingen, sind sich Klaus Andersen und Andreas Wieland sicher. Andersen war 2011 bis 2021 sogenannter Weltlicher Vorsteher der Evangelischen Brüdergemeinde. Wieland ist seit 2023 Geschäftsführer der Diakonie.
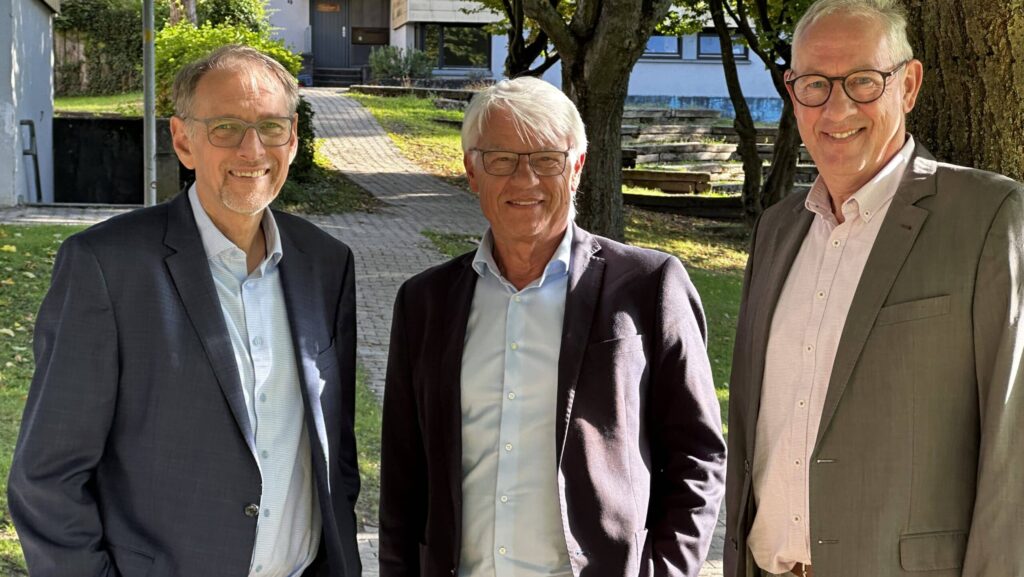
Beide zeigen sich selbstkritisch, was sowohl den ersten Anlauf zur Aufarbeitung als auch den Aufarbeitungsbericht von 2018 angeht. Andersen zu 2014: „Wir hatten damals ein Ziel und wollten aufklären, aber wir kannten nicht den Weg.“ Trotz einem eindeutigen Bekenntnis, dass sexueller Missbrauch in den Kinderheimen geschah, habe eine deutlich kommunizierte Verantwortungsübernahme gefehlt. Korntal sei zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, Betroffene nicht ausreichend ernst genommen worden. „Wir waren zu zögerlich, zu unklar.“ Sein Fazit für heute: „Aufarbeitung kann nur gelingen, wenn die Institution von Anfang an eine Prozessbegleitung in Anspruch nimmt.“
Wieland blickt auf 2018: „Es gab Situationen, in denen sich einzelne Betroffene nicht wertgeschätzt gefühlt haben.“ Empathie und Seelsorge habe gefehlt. Beide zeigen sich offen für eine Aufarbeitung des Aufarbeitungsprozesses, wie ihn manche Betroffene anstreben. Und noch etwas Spannendes offenbaren sie: Korntal hat eine 180-Grad-Wende in Sachen „Die Kinder aus Korntal“ vollzogen. Nicht nur wird der Film derweil regelmäßig Mitarbeitern vorgeführt. Derzeit werden die ersten Stellungnahmen mit Beteiligung von Betroffenen überarbeitet. Man habe zunächst sich selbst, die Mitarbeiter, schützen wollen, sagt Wieland. Doch im Laufe der Zeit und der Gespräche über den Film habe sich der Blickwinkel geändert.
Aufarbeitung endet nicht
„Der Gesprächsfaden ist nie abgerissen, auch nach der Veröffentlichung des Films nicht“, sagt Andersen. Und formuliert damit den wohl wichtigsten Grundsatz für Aufarbeitung: Im Gespräch bleiben. Was raten die beiden heute, nach elf Jahren Aufarbeitung, anderen Organisationen, die am Anfang stehen? „Sie müssen die Sorge um die eigene Reputation überwinden“, sagt Andersen. Wieland: „Nicht abwarten – denn warten bedeutet vermeiden – , sondern Aufarbeitung anpacken. Und immer wieder: das Gespräch suchen, und im Dialog bleiben“. Auch, wenn Betroffene sich dafür auf den Weg machen müssen und eventuell altes Leid neu durchleben. Auch, wenn Organisationen dazu eine neue, traumasensible Sprache lernen müssen. Auch, wenn ihr öffentliches Image zunächst leidet. Endet Aufarbeitung irgendwann? Nein, sind sie sich sicher. „Gedenkkultur ist ein Teil der Aufarbeitung, der weiterläuft in die Zukunft“, sagt Wieland. Und schließlich Gerd Sander, der Pressesprecher: „Aufarbeitung muss Teil der Unternehmenskultur werden.“
Korntal ist vieles gelungen, das sagt sogar Detlev Zander heute. Bei allem, was er sich noch an Veränderungen zugunsten der Betroffenen wünscht. „Beide Seiten müssen sich entwickeln. Denn Aufarbeitung funktioniert nur gemeinsam“, sagt er. „Es gab damals viele Verletzungen, aber ich habe auch viele verletzt“, erinnert er sich. Was wünscht er sich von Kirchen und Werken, in deren Reihen sexualisierte Gewalt geschehen ist? „Die Leitenden müssen alle Menschen in den Gemeinden mitnehmen und zeigen, was geschehen ist. Denn wer nicht in die Vergangenheit blickt, dem nützen die besten Schutzkonzepte nichts.“
Aufarbeitung, so wird nach viel Recherche und langen Gesprächen klar, bedeutet, aktiv zu werden. Sowieso bei einem oder mehreren Fällen, aber im Grunde schon vorher. Es ist die Pflicht jeder Kirche, jeder Organisation, Kontakt zu Fachberatungsstellen herzustellen, Schutzkonzepte zu entwickeln, aufmerksam zu sein und zu schulen, worauf im Umgang miteinander zu achten ist. Aufarbeitung, so zeigt sich, kann Gemeinden und Organisationen stark machen, anstatt sie zu zerstören, wie viele immer noch meinen. Und am allerwichtigsten: Sie dient dazu, Leid wie das von Detlev Zander zu verhindern. Die Schwachen zu schützen. Was, wenn nicht das, müsste Motivation für die sein, die Jesus nachfolgen wollen?
» Christlicher Star soll Minderjährige belästigt haben
Dieser Text ist Teil der Titelgeschichte der Ausgabe 5/2025 des Christlichen Medienmagazins PRO. Sie können die Ausgabe hier bestellen und mehr über das Thema erfahren.

