PRO: Sie haben eine umfangreiche Studie dazu gemacht, wie Christen über Sexualität denken und sie erleben. Dazu haben Sie in einer Diskursanalyse untersucht, wie in christlichen Büchern, Zeitschriften und Instagram-Posts darüber gesprochen wird, Sie haben vierzehn qualitative persönliche Interviews geführt und 10.000 Christen quantitativ online befragt. Von welchen Ergebnissen waren sie überrascht?
Tobias Künkler: Besonders überraschend fand ich, dass Glaube und Sexualität in wesentlichen Aspekten fast zwei getrennte Welten sind, die nebeneinander existieren, aber wenig miteinander zu tun haben. Das gilt nicht, wenn man sich die sexualethischen Einstellungen anschaut: Die hängen durchaus damit zusammen, wie intensiv die Befragten glauben und welche theologische Grundhaltung sie haben. Aber Erleben und Handeln in Bezug auf Sexualität, etwa sexuelle Zufriedenheit oder sexuelle Handlungsfähigkeit, die Stärke des sexuellen Begehrens, hängen kaum messbar mit Glaubensaspekten zusammen.
Leonie Preck: Mich hat überrascht, dass es in vielen christlichen Büchern zum Thema Sexualität einen sehr expliziten Doppelstandard gibt zwischen männlicher und weiblicher Sexualität. Zum Beispiel diese Idee, dass Frauen verantwortlich sind für die Sexualität des Mannes. Überspitzt gesagt: Die Frau, die ihrem Mann nicht sexuell zur Verfügung steht, ist am Ende selber schuld, dass er fremdgeht. Oder die Frau soll sich in der Gemeinde züchtig kleiden, damit sie nicht zur Versuchung für Männer wird. Das zweite Learning war: Alle unserer Interviewpartner und -partnerinnen haben ihre eigene sexualethische Prägung und Aufklärung eher negativ wahrgenommen. Dabei war es egal, ob sie eher säkular oder sehr religiös, liberal oder konservativ geprägt worden sind.
Dr. Tobias Künkler ist Professor für Interdisziplinäre Grundlagen der Sozialen Arbeit an der CVJM-Hochschule in Kassel und leitet das Forschungsinstitut „empirica“.
Leonie Preck ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an dem Institut.
Sie sprechen in der Studie von einem Liberalisierungstrend. Bei den sexualethischen Grundhaltungen, die Sie identifiziert haben, überwiegen unter den Befragten dennoch eher die konservativen Haltungen. Woran machen Sie den Liberalisierung-Trend fest?
Künkler: In der Diskursanalyse haben sich drei sexualethische Grundverständnisse gezeigt, die wir auch in der Befragung wiedergefunden haben. In der Tendenz waren da die konservativen Positionen stärker vertreten. Die Liberalisierung haben wir an der theologischen Grundhaltung festgemacht: Die Befragten sollten sich auf einem Strahl einsortieren zwischen theologisch liberal und konservativ – und wie das vor zehn Jahren war. Da haben wir zeigen können, dass es im Durchschnitt eine ganz klare Liberalisierung gibt, sowohl in der volkskirchlichen Breite, als auch etwa bei hochreligiös-freikirchlichen Christen. Zwischen der theologischen Grundhaltung und den sexualethischen Einstellungen gibt es hohe statistisch messbare Zusammenhänge. Deswegen kann man folgern, dass die Sexualethik sich in den letzten zehn Jahren bei sehr vielen Christen liberalisiert hat.
Preck: So eine tendenzielle Liberalisierung sehen wir auch in den untersuchten Büchern. In sehr vielen zeitlich früheren Büchern haben wir ein sehr konservatives Grundverständnis, wo Sexualität potenziell etwas Gefährliches ist. Da werden zum Beispiel viele Verbote formuliert und die Enthaltsamkeit vor der Ehe mit der Qualität der Sexualität in der Ehe in Verbindung gebracht. Im Zeitverlauf findet eine Aktualisierung hin zu einem gemäßigt konservativen Grundverständnis statt, was wir nur in neueren Büchern finden. Darin wird Sexualität stärker als ein Geschenk von Gott dargestellt, als etwas, das erlernt werden muss und nicht sofort ab der Ehe funktioniert.
Künkler: Das sind auch häufig deutschsprachige Bücher, während viele Bücher mit dem ersten Grundverständnis aus dem US-amerikanischen Kontext übersetzt wurden.
„Für fast alle war die ethische Vorstellung ‚kein Sex vor der Ehe‘ ein biografisches Thema, an dem sie sich irgendwie abgearbeitet haben. Die meisten von ihnen haben sich am Ende dann doch nicht an diese Norm gehalten.“
Sie stellen zum Teil auch deutliche Unterschiede – Inkongruenzen – fest zwischen der Sexualmoral und dem eigenen Verhalten. Haben diese auch mit solchen Normen und Grundhaltungen zu tun?
Künkler: Wir haben die Inkongruenzen nur bei denen messen können, die konservativere sexualethische Normen haben, denn nur bei denjenigen konnten wir Einstellung und Verhalten abgleichen. Wer sagt, er habe kein Problem damit, Pornografie zu konsumieren, der hat diesen moralischen Konflikt nicht. Damit ist noch nicht gesagt, die Normen wären das Problem. Es geht erst einmal darum, festzustellen, dass es einen gewissen Anteil der Christen gibt, ein Drittel etwa, wo Einstellung und Verhalten auseinanderklaffen. Und dann haben wir auch zeigen können, dass es einen messbaren Zusammenhang zwischen diesen Inkongruenzen und gesundheitlichen Aspekten gibt wie sexueller Zufriedenheit oder Hypersexualität. Männer und Singles sind besonders von den Inkongruenzen betroffen. Das sind für sich genommen starke Befunde. Wie man damit umgeht, was das sexualethisch und für die Seelsorge heißt, das sind andere Fragen.
Preck: Diese ethische Vorstellung von „kein Sex vor der Ehe“ kam in jedem der vierzehn qualitativen Interviews vor, obwohl wir nie explizit danach gefragt haben. Für fast alle war das ein biografisches Thema, an dem sie sich irgendwie abgearbeitet haben. Die meisten von ihnen haben sich am Ende dann doch nicht an diese Norm gehalten. Die einen haben sich liberalisiert und sich bewusst dafür entschieden, vor der Ehe oder mit verschiedenen Partnern Sex zu haben. Aber es gab auch die, die darunter litten, dass sie diese Norm nicht eingehalten haben und die dann der Überzeugung waren, dass das Auswirkungen auf ihre Ehe und ihre Paarsexualität hat. Bei diesen Befunden geht es nicht darum, zu bewerten, ob diese Moralmaßstäbe gut oder schlecht sind. Wichtig ist, hinzuschauen: Was macht es mit der Sexualität von Individuen, wenn es diese hohen Maßstäbe gibt und die dann vielleicht nicht eingehalten werden.
Sie haben auch nach Missbrauchserfahrungen gefragt und einen Zusammenhang festgestellt zwischen der Aufarbeitung von Missbrauch und der Gottesbindung. Wie können sich Missbrauch und seine Aufarbeitung auf die Gottesbeziehungen von Betroffenen auswirken?
Künkler: Wir haben quantitativ messen können, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einer weniger sicheren Gottesbindung und der Aufarbeitung von erfahrener sexualisierter Gewalt. Daran wird deutlich, dass es auch eine geistliche Dimension hat, wenn jemand sexualisierte Gewalt erfährt, und wie wichtig es ist, dass so etwas aufgedeckt und angemessen aufgearbeitet wird. Darin liegt eine hohe geistliche Verantwortung. Auch in unserer Dekonversionsstudie, warum Menschen nicht mehr glauben, gab es viele, die sehr verletzende Erfahrungen gemacht haben im kirchlichen Kontext. Da mag man erst mal fragen: Warum können die Betroffenen nicht trennen zwischen den Menschen, die ihnen so etwas zufügen, und Gott? Aber wir sind eben als Menschen von Gott als Beziehungswesen geschaffen; die Beziehungsebenen zu uns selbst, zu anderen und zu Gott sind nicht komplett zu trennen.
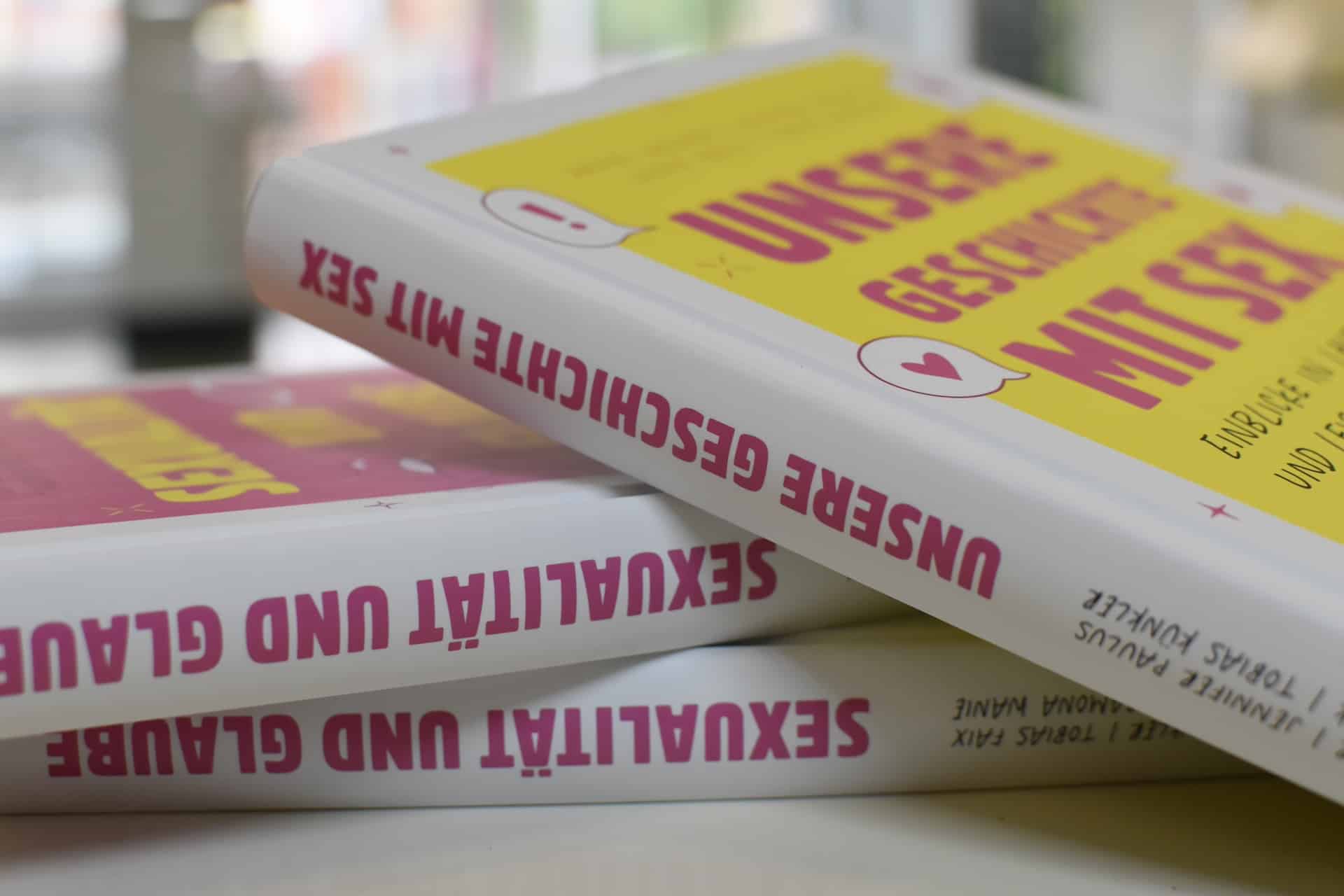
Veröffentlichungen zur Studie
Zur Sexualitätsstudie von „empirica“ sind bei SCM R.Brockhaus zwei Bände erschienen. Die Ergebnisse der quantitativen Auswertung stellen Tobias Künkler, Tobias Faix, Tabea Peters und Ramona Wanie in „Sexualität und Glaube. Prägungen, Einstellungen und Lebensweisen“ vor. Die einzelnen Kapitel sind ergänzt um Kommentare von anderen Theologen und Fachexperten, die Methoden und Erkenntnisse der Studie aus einem jeweils eigenem Blickwinkel beleuchten.
Im Band „Unsere Geschichte mit Sex“ präsentieren Daniel Wegner, Jennifer Paulus,
Leonie Preck und Tobias Künkler die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung. Dabei liegt der Fokus darauf, wie sich Vorstellungen von Sexualität konkret im Leben einzelner Menschen widerspiegeln.
Eine Zusammenfassung der Studienergebnisse sowie der Forschungsbericht stehen zum Download zur Verfügung.
An Ihrer Studie wurde die Kritik geäußert, Sie würden mit der Interpretation Ihrer Ergebnisse eine liberale Sexualethik fördern, statt sich an den biblischen Maßstäben zu orientieren. Tatsächlich formulieren Sie als eine Schlussfolgerung nicht etwa, wir müssen zurück zu den biblischen Wurzeln, sondern Sie sagen, Gemeinden müssen die vielfältigen sexualethischen Anschauungen anerkennen. Warum ziehen sie das eine und nicht das andere Fazit?
Künkler: Natürlich sollte sich eine Sexualethik an den biblischen Befunden orientieren. Das ist für mich selbstverständlich. An der Kritik hat mich schockiert, dass auf die eigentlichen Ergebnisse kaum geschaut wurde. Wichtig dabei ist doch, erst mal wahrzunehmen, dass es unterschiedliche sexualethische Ansichten unter Christen gibt. Egal welches sexualethische Grundverständnis man hat, man ist von manchen Ergebnissen herausgefordert und wird in anderen bestätigt. Natürlich soll man keine Ethik aufgrund dieser Ergebnisse entwickeln, das wäre ja absurd.
Sie fordern als ein Fazit auch, dass die theologische Diskussion zu diesen Fragen intensiviert wird. Was wäre das Ziel davon?
Künkler: Ich persönlich bin davon überzeugt, dass der christliche Glaube, Jesus nachzufolgen, Menschen befreit. Deshalb sollten wir uns auch ohne Angst mit vielleicht herausfordernden Ergebnissen kritisch auseinandersetzen und um theologische Wahrheit ringen. Ich maße mir nicht an, zu sagen, was die richtige Sexualethik ist. Ich werbe darum, dass wir die biblische Offenbarung absolut ernst nehmen als entscheidende Quelle dafür. Aber wir leben auch in einer bestimmten Zeit und müssen uns mit ihren Werten und mit dem, wie Menschen konkret leben und welche Einstellungen sie haben, auseinandersetzen. Und dann zu einer Sexualethik kommen, die sich heute als tragfähig erweist.
Preck: Ich wünsche mir für den theologischen Diskurs, dass er nicht fernab von den Menschen stattfindet, sondern dass wir uns anschauen: Was macht diese Theologie mit Menschen in der Gemeinde? Wie kommuniziere ich bestimmte Dinge? Da gibt es auch anhand der Studienergebnisse ein ganz großes Lernpotenzial. Aber dafür müssen wir darüber ins Gespräch kommen.
Künkler: Für Gemeinden ist die Ethik gar nicht das Entscheidende, sondern vor allem sexuelle Bildung, Sexualaufklärung auch in einem viel breiteren Sinne. Da fehlt manchmal ganz handfest Wissen. Viele Fragen werden überhaupt nicht adressiert. Menschen zu befähigen, mündig und sprachfähig zu machen, ist aus meiner Sicht ein wichtiges Ziel.
Welche Fragen müssten denn Gemeinden noch genauer adressieren?
Preck: Die Menschen wünschen sich, dass Sexualität in der Gemeinde besser, qualitativer kommuniziert wird. Verheiratete Interviewpartnerinnen haben zum Beispiel gesagt: Bis zur Ehe wird über Sexualität gesprochen. Aber was dann wirklich in der Ehe passiert, darüber können sie mit niemandem reden.
Künkler: Wir haben etwa den positiven Befund, dass fast drei Viertel der verheirateten Befragten relativ zufrieden sind mit der Sexualität in ihrer Ehe. Diese Zufriedenheit hängt aber gar nicht mit religiösen und Glaubensaspekten zusammen. Sehr viel hängt davon ab, wie gut die Paare über ihre sexuellen Bedürfnisse miteinander sprechen können. Es dreht sich manchmal so viel um die Debatte, Sex vor der Ehe, ja oder nein, oder was passiert, wenn nicht. Dabei werden aber Menschen gar nicht ganz konkret darin befähigt, wie sie über ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche zumindest mit ihrem Partner, ihrer Partnerin sprechen. Was kann dabei helfen? Und wie kommt man da in einen unverkrampften Austausch?
Vielen Dank für das Gespräch!

