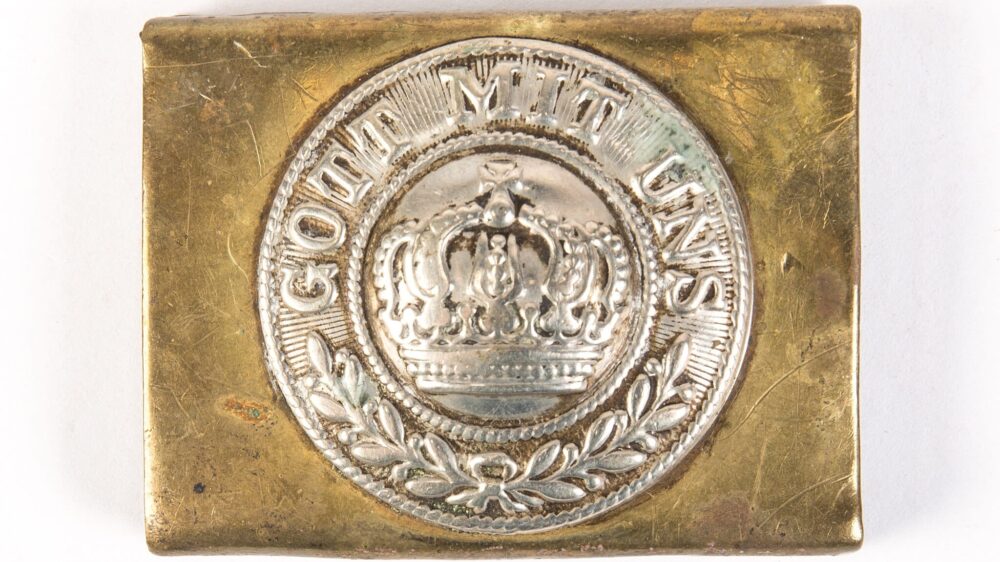„Wir opfern die Stärke unseres Volkes auf dem Altar des Vaterlandes“, verkündete der pfälzische Pfarrer August Kopp seiner Gemeinde zum Erntedankfest 1914. Mit jedem Mann, der an die Front gezogen war, sei „ein Stück von unserm Herzen“ mitgegangen: „Wenn es gleich zerreißen wollte, wir haben es gegeben und werden das letzte geben.“ Im gesamten Deutschen Kaiserreich ertönten während des Ersten Weltkriegs von den Kanzeln Ansprachen, die das Sterben im Krieg verherrlichten. Die Kirchenhistorikerin Andrea Hofmann hat evangelische Kriegspredigten aus jener Zeit erforscht. Sie stieß auf viele schwer erträgliche Passagen und auf manche nachdenkliche Zwischentöne.
Hofmann, die mittlerweile an der Universität Basel lehrt, hatte ihre Habilitationsschrift am Mainzer Institut für Europäische Geschichte eingereicht. Sie analysiert darin die „Kriegsbilder“ protestantischer Pfarrer aus dem Südwesten des Kaiserreichs. Neben bereits damals zur „Erinnerung an glorreiche Zeiten“ publizierten Schriften konnte sie teils handschriftlich verfasste Nachlasse auswerten: „An der Politik wurde kaum gezweifelt. Der Krieg wurde als ein Angriffskrieg betrachtet, in dem Deutschland sich lediglich verteidigte.“
Schon kurz nach Kriegsbeginn wurden in den Gemeinden zusätzlich zu den Sonntagsgottesdiensten sogenannte Kriegsbetstunden etabliert, in denen den Ängsten der Bevölkerung das christliche Heilsversprechen entgegengehalten wurde. In ihren Predigten versuchten die Pfarrer, dem Sterben in den Schützengräben einen theologisch aufgeladenen Sinn zu geben, indem sie den Deutschen – wie dem biblischen Volk Israel – eine ganz besondere historische Mission zusprachen. Trauernde Angehörige wurden damit getröstet, der Tod an der Front komme dem Opfertod Jesu gleich.
Hasspredigten gegen den Feind
Mit Eifer beteiligten sich die frommen Kirchenmänner zudem an der Dämonisierung der Feinde. Sie wetterten gegen sittenlose Franzosen und deren „gallische Rachgier“, die „asiatische Unkultur“ der Russen und über die Engländer, die trotz ihrer vermeintlichen „Blutsverwandtschaft“ zum Kriegsgegner geworden waren. „Man kann sehen, wie Kriegspredigten Stereotypen der weltlichen Propaganda aufnahmen“, sagt Hofmann. „Es sind tatsächlich Hasspredigten.“
Teil von Hofmanns Untersuchung war mit dem damals zu Deutschland gehörenden Elsass eine Region, in der sich zahlreiche Menschen noch immer Frankreich verbunden fühlten. Dort kam es vor, dass sich Theologen dem Zeitgeist widersetzten. Charles Gérold etwa, Pfarrer an der Nikolaikirche in Straßburg, wurde wegen vermeintlich zu frankreichfreundlicher Einstellungen vom Dienst suspendiert. Zugezogene Kirchenleute aus anderen Teilen des Reichs zeichneten sich durch besondere Unnachgiebigkeit aus.
In den erhaltenen Predigten gab es nahezu keine offene Kritik am Kriegskurs, dennoch tauchten bereits nach Kriegsbeginn auch fragende Untertöne auf, insbesondere im ländlichen Raum, schildert die Historikerin. Schon im Herbst 1914 thematisierten Pfarrer die Ängste der Landbevölkerung, etwa wie Frauen und Kinder denn allein die Ernte einbringen sollten.
Als der – anfangs dank Gottes Zuspruch für sicher erachtete – Sieg ausblieb, machte sich auch in den Gottesdiensten Ernüchterung breit. Die Ursache des Desasters war für viele protestantische Kirchenleute klar: Das deutsche Volk war weniger fromm als vermutet. „Während Tausende auf dem Schlachtfeld bluteten, haben andere Tausende daheim nur daran gedacht, wie sie zusammenraffen können“, formulierte der Wiesbadener Pfarrer und spätere nassauische Landesbischof August Kortheuer 1918 eine kirchliche Variante der sogenannten Dolchstoßlegende. „Während die Front eisenfeststand, ist die Heimat kleinmütig, verzagt, verdrossen gewesen.“
Andere Stimmen fanden sich wiederum im Elsass. „Es muss einen Fortschritt geben“, sagte der Missionsarzt und Theologe Albert Schweitzer 1918 in Straßburg. „Es muss eine Menschheit kommen, in der die Völker durch geistige Ziele miteinander geeint sind.“