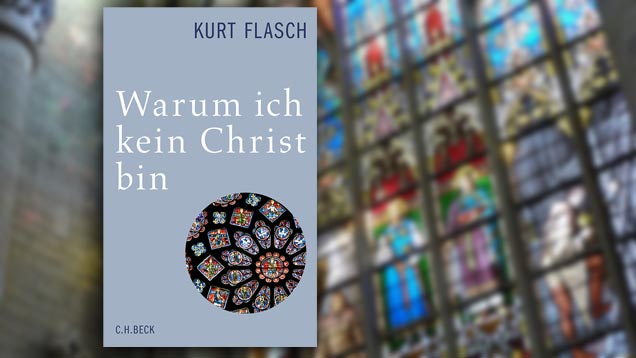Als ob es um das Christentum in Europa nicht schon schlecht genug bestellt ist. Kirchenbänke leeren sich, Millionen der verbliebenen Kirchenmitglieder glauben nicht an Gott. Mitten hinein in die Misere veröffentlicht der Philosophiehistoriker Kurt Flasch ein Buch mit dem Titel „Warum ich kein Christ bin“. Erhalten die letzten Zauderer nun eine entscheidende Wegweisung für ihre endgültige Abkehr vom Christentum? Läutet das Buch den nächsten Säkularisierungsschub ein?
Flasch liegt es fern, seine Leser zum Kirchenaustritt oder zur Entsagung vom christlichen Glauben zu bewegen. Keine der 280 Seiten seines Werkes soll sich als Polemik gegen das Christentum lesen. „Ich erhebe diesen Vorwurf nicht, ich stelle nur fest“, erklärt er mehrmals, wenn er christliche Standpunkte kritisiert. Sein Buch weist er als „Bericht und Argumentation“ aus. Er möchte „in aller Ruhe“ darlegen, an welchen Stellen ihm das Christentum derart unstimmig erscheint, dass er es nicht für „wahr“ hält.
Natürlich weiß Flasch, dass es nicht „das Christentum“ gibt. Im Buch kritisiert er aber vor allem katholische Traditionen. Er selbst wuchs in Mainz in einer „gut katholischen“ Familie auf. Skeptisch gegenüber dem christlichen Glauben war er schon früh, die endgültige Abkehr kam jedoch „langsam und relativ akribisch“.
Die zehn Kapitel entspringen also einem lebenslangen Denkweg, konkret aber einer mehrstündigen, zweisemestrigen Vorlesung Mitte der 1990er Jahre an der Ruhr-Universität Bochum, wo der heute 83-Jährige von 1970 bis zu seiner Emeritierung 1995 wirkte. Flasch hat in zahlreichen Vorlesungen und Büchern erklärt, wie in früheren Zeitaltern in Europa gedacht wurde. Als Historiker brachte er unverbesserlichen Schwärmern bei, dass auch der spätantike Denker Augustinus nicht zeitlosen Wahrheiten das Wort redete, sondern in seinen Überlegungen ein Kind seiner Zeit war.
Wie hältst du’s mit der Tradition?
In seinem jüngsten Werk konzentriert sich Flasch vor allem auf die christliche Lehrentwicklung und geht dabei nur „teilweise auf die Bibel zurück“. Dieses Verfahren wirft natürlich die Frage auf, wie redlich es ist, bei einer Auseinandersetzung mit dem Christentum den Blick in dessen Grundtext zum Sonderfall zu erklären. Flasch verwendet die meisten Seiten seines Buches darauf, dem Leser die Irrungen und Wirrungen der Theologiegeschichte vor Augen zu führen.
Dabei merkt Flasch selbst kritisch an, dass die „Tradition“, zum Beispiel die Gottesbeweise eines Ockham oder eines Thomas von Aquin, kaum jemals ein Grund waren, Christ zu werden. Das ist richtig. Unbotmäßig ist hingegen Flaschs Einteilung von Theologen: diejenigen, die die „Tradition“ nicht kennen oder zugunsten eines „trutzigen Glaubens“ über Bord werfen, und diejenigen, die Lehrsätze einfach nur nachsprechen. Von Theologen, die diese Traditionen kennen und sie nach kritischer Prüfung zurückweisen, spricht Flasch nicht.
Viele dieser letztgenannten Theologen weisen die Traditionen deshalb zurück, weil sie eher philosophischen Denkmustern denn der Bibel entnommen sind. Dem Christentum ging es nie wie der Philosophie darum, die Gesetze des menschlichen Geistes zu erkunden. Es erhebt auch keine Ansprüche auf die an sich legitimen philosophischen Wahrheitsbegriffe wie „Übereinstimmung von Geist und Wirklichkeit“. Der Höhe der biblischen Aussagen entspricht es jedoch auch nicht, wenn Flasch den religiösen Wahrheitsbegriff ausschließlich in „Geschichten“ verortet, die Menschen „etwas sagen“, ihnen also beispielsweise zu einem besseren Leben verhelfen. Dass die Wahrheit, von der die Bibel spricht, weder „Konzept“ noch „Geschichte“ ist, sondern mit Jesus Christus „in Person“ gekommen ist, erwähnt Flasch nicht.
Philosophische Traditionen transportieren außerdem ein Gottesbild, das mit dem biblischen Gott nicht vereinbar ist. Der Neuplatonismus redete etwa einem Gott das Wort, der als weltabgewandt gilt und von dem sich darüber hinaus nichts sagen lässt. Auch den philosophischen Gottesbegriff, der Gottes Eigenschaften gegen die des Menschen ausspielt, erkennt Flasch richtig als Import aus heidnischer Philosophie.
Flaschs brutaler Gott
Dass er aber bei diesem „Gott der Philosophen“ bleibt und Christen genau diesen vorhält, liegt an dem bereits erwähnten fahrlässigen Umgang mit der Bibel. Bei der Behandlung des „Gottes der Väter“ greift sich Flasch diejenigen Bibelstellen im Alten Testament heraus, die ein brutales Gottesbild nahelegen oder einen Gott suggerieren, der einzig und allein für das Volk Israel da ist. Flasch unterschlägt dabei diejenigen Stellen, die besagen, dass Gott fürsorglich ist, sein Volk Israel auch einmal verwirft und im Übrigen der Gott aller Menschen sein möchte. Ohne diese Gotteserfahrungen, die im Alten Testament gesammelt sind, zu unterschlagen, ist für Christen letztlich entscheidend, wie sich Gott mit Jesus Christus gezeigt hat.
Für Flasch ist der Gott der Bibel jedenfalls nicht hinnehmbar. Er unterstellt aber, dass es Christen genau so ergehe und sie daher dem „Gott der Philosophen“ anhingen. Das äußert sich in dem vermeintlichen Vorwurf, der Gott der Christen könne angesichts des Leids in der Welt nicht „glücklich“ sein. Die Bibel spricht jedoch von einem Gott, dem es nicht in erster Linie um sein Glück, sondern um die Beziehung zu seinen Geschöpfen geht. Der mit den Menschen nicht nur mitleidet und Interesse an seiner Schöpfung hat, sondern in diese auch eingreift – wie er es bei der Auferweckung Jesu Christi getan hat –, anstatt die Schöpfung sich selbst zu überlassen.
Laut Flasch wäre letzteres die einzige Möglichkeit für Gott, „glücklich“ zu sein. Das ist eine erstaunliche Aussage für einen bekennenden Agnostiker, der also von sich behauptet, nicht einmal wissen zu können, ob Gott nun existiert oder nicht.
Die Frage der Auferstehung
Bei der Auferstehung befasst sich Flasch noch am intensivsten mit dem Bibeltext. An diesem Thema entscheidet sich für ihn, was Christsein bringt. Und richtig, denn nach 1. Korinther 15,14 ist der christliche Glaube ohne Auferstehung „vergeblich“.
Flasch geht bei der Betrachtung der biblischen Zeugnisse von der Auferstehung allerdings selektiv vor: Er wählt das aus, was seiner Argumentation dient. Er zielt also auf einander widersprechende oder voneinander abweichende Stellen. So stellt er fest, dass das Markus-Evangelium von drei Frauen spricht, die zum leeren Grab kommen, im Matthäus-Evangelium sind es deren zwei, Paulus erwähnt überhaupt keine Frauen.
Wollte man tatsächlich auf diese Abweichungen im Detail eingehen, müsste man Flasch vorwerfen, dass er hier zu ungenau vorgeht und dann zu falschen Beobachtungen kommt: Denn Matthäus spricht mit Blick auf die Frauen am Grab sowohl von deren Freude als auch von deren Furcht und steht damit nicht im Gegensatz zu Markus, der nur von ihrer Furcht spricht.
Gewichtiger sind jedoch die vermeintlichen Widersprüche in den Beschreibungen des Auferstandenen selbst. Einmal sei von Erscheinungen die Rede, besonders in den frühen Texten wie 1. Korinther 15. Die Evangelien, erklärt Flasch, „bestreiten“ dann aber diesen Eindruck der „Immaterialität“ des Auferstandenen, den Paulus wecke, wenn er etwa vom „geistlichen Leib“ spreche.
Zeugnis der Neuschöpfung
Flasch sieht an dieser Stelle einen Widerspruch zwischen Paulus und den Evangelien, weil er in eine „Entweder – Oder“-Denkweise verfällt: Entweder die Auferstehungswirklichkeit ist „rein geistig“ oder aber „körperlich“. Dieser Wunsch nach eindeutigen Bestimmungen mag bei einfachen Realitäten ihr Recht haben. In diesem Fall ist es aber unangemessen, weil die Bibel von der Wirklichkeit einer Neuschöpfung spricht und diese spannungsreich beschreibt: Einmal ist von Lichterscheinungen die Rede, Jesus taucht plötzlich unter den Jüngern auf, um dann vor ihren Augen zu verschwinden. Zugleich sprechen die Zeugnisse von einem im wahrsten Sinn des Wortes greifbaren Auferstandenen, dessen Wundmale sichtbar sind und der mit den Jüngern Speisen zu sich nimmt.
Paulus bringt diese Auferstehungswirklichkeit mit der Wendung „geistlicher Leib“ auf den Punkt. Flasch legt ihm an einer Stelle den Begriff „geistiger Leib“ in den Mund. Aber Paulus redet entgegen Flaschs Deutung eben nicht von der „Immaterialität“ des Auferstandenen. Warum sonst sollte er die Gemeinde in Korinth auf die leibhaftige Wirklichkeit der Auferstehung geradezu verpflichten?
Falsch ist auch Flaschs Bemerkung, über diesen „geistlichen Leib“ sei nichts zu wissen. Doch bietet die Bibel eine Fülle von Beschreibungen der Auferstehungswirklichkeit. Dabei ist vor allem wichtig, dass Jesus nicht einfach physisch wiederbelebt wurde wie etwa Lazarus, sondern in einem unverweslichen Leib auferstanden ist. Dieser überbietet die bekannte physikalische Wirklichkeit, „entflieht“ ihr jedoch nicht, sondern bleibt an sie gebunden. Die Bibel legt außerdem nahe, dass der Auferstandene, anders als der Jesus vor der Kreuzigung, nicht nur sündlos ist, sondern sich auch mit der Sünde überhaupt nicht mehr auseinandersetzen muss.
Zu wissen, worum genau es sich bei der Auferstehungswirklichkeit handelt, ist deshalb wichtig, weil diese die Zukunft jedes Christen ist. Die Bibel spricht mehrmals davon, dass Christen „wie Jesus“ auferstehen werden. Sie haben keine vage Hoffnung auf ein „seliges Leben“, sondern können anhand seiner Person genau benennen, worin ihre Hoffnung besteht. Daher ist Jesus Christus für sie die „Wahrheit in Person“.
Für Flasch bleiben die Auferstehungszeugnisse unstimmig. Dennoch räumt er ein: „Wenn Zeugen sich widersprechen, beweist das Historikern nicht, dass nichts passiert ist.“ Die Bibelstellen sprechen für ihn weder für noch gegen die Auferstehung als „wirkliches“ Ereignis. Er gesteht jedoch zu, dass die Erzählungen vom Auferstandenen, unabhängig von ihrem Wirklichkeitsgehalt, vielen Menschen Lebensmut geschenkt und damit ihr Recht haben.
Subtile Polemik
Äußerungen wie diese bestärken den Eindruck, dass Flasch darum bemüht ist, jede Provokation gegenüber Christen zu vermeiden. Diese findet auf subtile Weise dennoch statt: Zunächst erklärt er, dass er zwar von „Mythen“ in der Bibel spricht, er diesen Begriff aber neutral als „Erzählungen“ verstanden wissen möchte, was der ursprünglichen Bedeutung im Altgriechischen auch entspricht. Wenn er sich dann aber darüber mokiert, dass die Schöpfungsberichte von einem Gott erzählen, der im Garten Eden wandelt, als ob er Beine hätte, wischt er sie doch verächtlich beiseite. Denn klar ist, dass die Schöpfungsberichte zunächst für Menschen früherer Zeitalter geschrieben wurden und poetisch ausgemalt sind. Wer die Berichte aber deswegen abtut, dem entgeht, dass sie ein komplexes und belastbares Weltbild bieten, das bis heute nichts an seiner Relevanz eingebüßt hat.
Lobend erwähnen hätte Flasch sie etwa können mit dem Verweis auf ihre Bedeutung, denn im Vergleich zu anderen Berichten dieser Zeit kommen sie erstaunlich nüchtern, geradezu „säkular“ daher, weil sie die Sterne nicht als „Götter“, sondern als „Funzeln“ darstellen. Die Berichte bieten auch eine Absage an den theistischen Gottesbegriff, da Gott ihnen zufolge nicht alles alleine macht, sondern die Geschöpfe an der Schöpfung beteiligt und auf deren Bedürfnisse eingeht.
Kein Erlösungsbedürfnis?
Völlig unverständlich ist jedoch Flaschs Bemerkung, Christen wüssten gar nicht mehr, wovon sie eigentlich erlöst seien. Dabei schließt er ausdrücklich von sich auf die Allgemeinheit. Sein Dasein beschreibt er als „prekär“ und „fehlerhaft“, aber als nicht „erlösungsbedürftig“. „Wahrscheinlich geht es den meisten Menschen in Westeuropa ähnlich. Der Erlösungsreligion Christentum entspricht kein Bedürfnis mehr.“ Angesichts (tödlicher) Krankheiten, Umweltkatastrophen, unerträglicher Einsamkeit, Verstrickungen in Schuldzusammenhänge und des tödlichen Ausgangs jedes Lebens irrt Flasch, wenn er Menschen (in Westeuropa) Erlösungsbedürftigkeit abspricht.
Flasch ist zugute zu halten, dass er kenntlich macht, was für eine Perspektive er einnimmt: Seine Analyse des Christentums schreibt er aus europäischer Sicht, mit historisch-kritischem Blick und Fokus auf die Tradition des Christentums und ihre Schwachstellen. Der geringe Stellenwert der Bibel führt jedoch zu einer rüden Auslegung der Bibeltexte und damit zu einer verzerrten Darstellung des Christentums. Seine Äußerungen bleiben einseitig und erfassen nicht die subtilen Nuancen, die beispielsweise in den Schöpfungsberichten zu finden sind.
Trotz seiner Schwächen ist das Buch empfehlenswert. Denn Flasch stellt grundsätzlich legitime Fragen zum Christentum und seiner Tradition, mit denen Christen sich auseinandersetzen sollten. Lediglich die Behandlung dieser Fragen lässt zu wünschen übrig. Der Vorwurf Flaschs, manche Christen redeten schwierige Bibelstellen weg oder ignorierten sie, ist nicht von der Hand zu weisen. Andererseits sind auch Christen, die ihren Glauben ernst nehmen, anders als Flasch meint, dazu in der Lage, frei zu denken und ihren Zweifeln nachzugehen.
Kurt Flasch, „Warum ich kein Christ bin. Bericht und Argumentation“, C. H. Beck, 280 Seiten, 19,95 Euro, ISBN 9783406652844