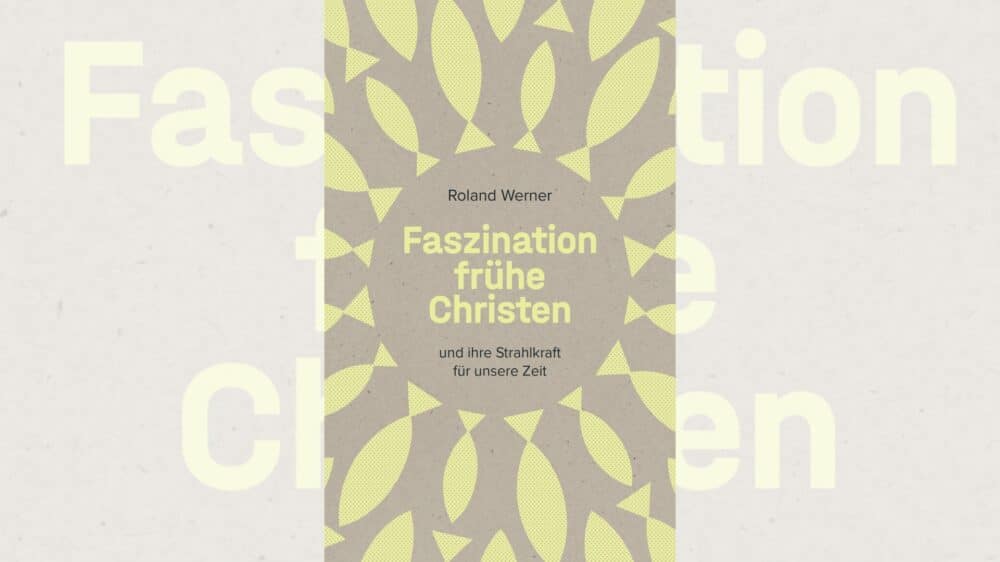Roland Werner lässt in seinem neuen Buch die Welt der ersten Christen vor dem inneren Auge lebendig werden. Der Sprachwissenschaftler und Theologe spannt dabei einen zeitlichen Bogen von den Jüngern Jesu, die noch selbst mit ihm unterwegs waren, über die Apostel, die nur noch teilweise Jesus persönlich, dafür aber dessen Zeitgenossen kannten, bis hin zu den Kirchenvätern.
Was geschah mit den Christen nach dem Tod des letzten Apostels Johannes um 98 n. Chr.? Wie entwickelte sich die Jesusbewegung weiter? Welche Überzeugungen prägten die frühen Christen? Was gab ihnen die Kraft, auch in Widerständen und Verfolgungen durchzuhalten? Diese Fragen geht Werner auf gut lesbaren 250 Seiten verständlich sowohl für Theologen, als auch für Laien, an. Werner will sein Buch ausdrücklich als Einführung verstanden wissen, als „Inspiration, sich weiter mit dieser spannenden Frühzeit zu beschäftigen“.

Werner, Gründer des Marburger Christus-Treffs und früherer CVJM-Generalsekretär, spricht von „einem der spannendsten Abschnitte der Weltgeschichte“, dessen Ende er auf etwa 330 n. Chr. legt, als die römischen Kaiser Galerius, Konstantin I. und Licinius das Christentum als rechtmäßige Gottesverehrung anerkannten. In der Reformation, und auch heute noch, berufen sich Theologen häufig direkt auf die frühen Christen und die Kirchenväter. Spannend ist hier Werners Blick auf eine „unverbrauchte “ Christenheit, welche die späteren Trennungen in orientalische, orthodoxe, katholische und protestantische Kirchen und Konfessionen noch nicht kannte.
„Erst überwanden Christen das Römische Reich von innen, dann höhlte das Reich die Kirche von innen aus“
„Die von den frühen Christen gelebte alternative Kultur durchdrang die antike Welt wie ein Sauerteig“, schreibt Werner. Ihre geistliche und intellektuelle Klarheit, ihre praktische Liebe und ihre ethischen Überzeugungen waren „eine Kraft, die das mächtigste Weltreich der Antike, das kaiserliche Römische Reich, von innen her transformierte“. Diese „Outcasts“ lehnten die antiken Götter ab, weigerten sich, den Kaiser als Gott zu verehren, mieden die Theater und Gladiatorenspiele, waren mutig und entschlossen und hatten oft nicht einmal Angst vor dem Tod. Außerdem revolutionierten sie den Umgang mit Frauen. (In einem eigenen Kapitel geht Werner auf die neue Wertschätzung von Frauen ein; sie bildeten oft die Mehrzahl der christlichen Gemeinden.) Ihre Haltung führte zum Aufbau von Schulen und Krankenhäusern und langfristig zur Abschaffung der Sklaverei und zu vielen weiteren sozialen Verbesserungen.
Werner beleuchtet im Buch auch – leider etwas kurz – die frühe Verbindung von Kirche und Staat. „Christen begannen, staatliche Gewalt um Hilfe anzurufen, damit diese gegen andersdenkende Christen vorging. (…) Das bekamen im 5. Jahrhundert die Donatisten in Nordafrika genauso zu spüren wie später im Mittelalter die Waldenser und Hussiten sowie die reformatorischen Täufer und allgemein evangelische Christen im Zeitalter der Reformation und danach.“ Es sei laut Werner „erschreckend, wie leichtfertig die Warnung von Jesus vergessen oder verdrängt wurde, der gegenüber dem Vertreter der römischen Staatsgewalt gesagt hatte: ‚Mein Reich ist nicht von dieser Welt!’“ Die Entwicklung lasse sich so zusammenfassen: „In den ersten drei Jahrhunderten überwanden die Christen das Römische Reich von innen, doch nun begann das Reich, die Kirche von innen auszuhöhlen.“
Erster Bischof von Rom
Dieser Übergang von lose organisierten ersten Christengemeinden hin zur institutionalisierten Kirche wäre vielleicht einen tieferen Blick wert gewesen; aber würde wohl wiederum ein eigenes Buch beanspruchen. Allen voran beanspruchte Rom früh eine Vorreiterrolle unter den Christen, woraus später die Katholische Kirche hervorging. Werner erlaubt einen Einblick in diese Entwicklung, etwa wenn er über Clemens, den ersten Leiter der Christen in Rom schreibt.
Clemens antwortete in einem Brief auf einen Aufruhr in der Gemeinde in Korinth. Man erfährt nicht viel, nur: „Eine jüngere Generation hatte dort offenbar eine Revolte angezettelt. Die Ältesten waren von ihnen abgesetzt worden.“ Man erfährt nicht, welchen Grund die Jüngeren hatten. Trotzdem weiß Clemens aber offenbar genug, um den Aufstand zu verurteilen, er mahnt zu Frieden und Ruhe, um des Rufes der Gemeinde Willen. Wer aber hat eigentlich wirklich Autorität, für sich beanspruchen zu können, Gottes Willen zu erkennen? Wer garantiert dafür? Wiegt der Image-Schaden der christlichen Gemeinde nach außen schwerer als eine Klärung von Streitigkeiten im Inneren? Wann endet notwendige Leiterschaft, wann beginnt geistlicher Missbrauch?
Fisch-Graffiti der ersten Christen
Werners Buch hält, was der Titel verspricht: „Faszination frühe Christen“. Der Theologe präsentiert zahlreiche historischen Quellen, die uns das Leben der ersten Christen näher bringen; Schriften ebenso wie archäologische Funde. Da sind etwa die schon ab dem 1. Jahrhundert nachweisbaren Graffiti in den Gräbern der frühen Christen, frühe Darstellungen des guten Hirten, der sein Schaf auf den Schultern trägt, oder Symbole wie den Anker und den Fisch. Werner erinnert an den Fund des Wohnhauses von Simon Petrus und Andreas im Fischerdorf Kapernaum, in dem Jesus ein- und aus ging, aß und übernachtete. Vor kurzem fand man zudem den Siegelring des Pilatus, des römischen Statthalters zur Zeit Jesu.
Dass das Buch kein reines Geschichtsbuch sein will, sondern sich explizit an Christen richtet, zeigen – abgesehen vom christlichen Verlag, in dem es erschienen ist – die den Kapiteln angefügten Mahnungen zur jeweils behandelten Person XY: „Was wir heute von XY lernen können“. Diese Ratschläge wirken etwas belehrend – der Leser kann eigene Schlüsse ziehen. Am Ende zieht Werner eine Bilanz: Was heutige Christen von den Urchristen lernen können. Ein insgesamt sehr erhellendes Buch, das sowohl für Theologie- als auch für Geschichtsinteressierte spannend ist.
Roland Werner: „Faszination frühe Christen: … und ihre Strahlkraft für unsere Zeit“, Erscheinungstermin: 26. Mai 2025, 288 Seiten, 19,90 Euro, Verlag Fontis, ISBN 9783038482956