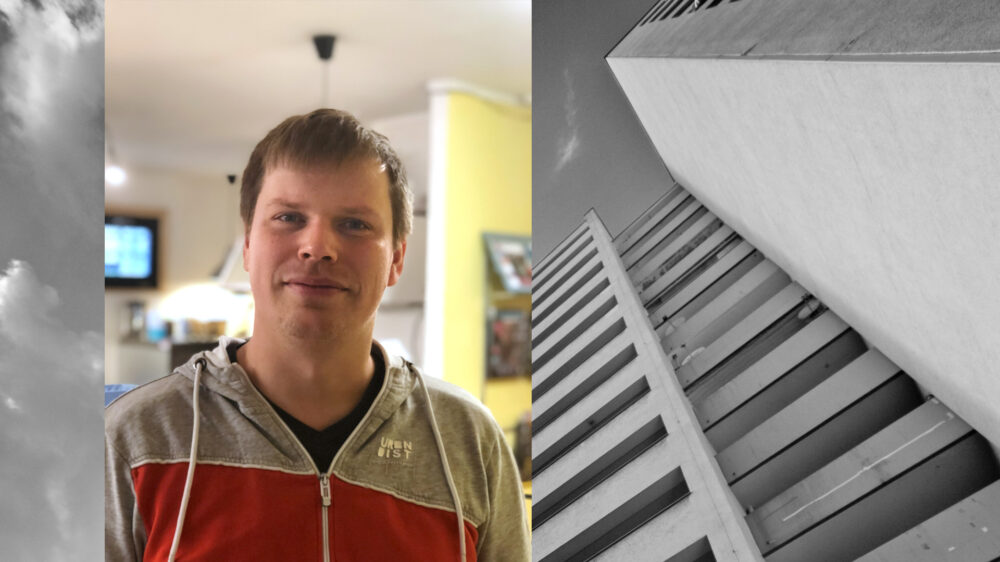pro: Herr Schmidt, am 14. Oktober ist in Ihrem Viertel ein achtjähriger Junge von einem Baumstumpf erschlagen worden. Wie haben Sie von dem Todesfall erfahren?
Torsten Schmidt: Ich war vor Ort. Es ist sonntags passiert und wir hatten geöffnet. Als ich zur Arbeit kam, sah ich Rettungskräfte und Krankenwagen. Ich habe mich zunächst nicht gewundert, das kommt bei uns öfter mal vor. Als aber dann auch noch Polizeiwagen kamen, war mir klar, dass da etwas Ungewöhnliches im Gange war. Die Kinder haben mir dann auch gleich alles Mögliche über den Vorfall erzählt. Sie müssen sich vorstellen: Wer hier in den Häusern wohnt, bekommt schnell mit, was im Viertel passiert. Geschichten verbreiten sich schneller als im Internet. Die Stimmung in der Baracke, unserem CVJM-Haus, war entsprechend gedrückt an dem Tag. Es kamen auch viele Eltern bei uns vorbei und haben das Gespräch gesucht. Hinzu kam das Rätselraten, es wusste ja noch niemand, was passiert war.
Heute wissen wir es. Ein Teenager hat einen Baumstumpf von einem Balkon im 15. Stock geworfen und damit einen Jungen namens Ibrahim erschlagen. Offenbar war das ein Unfall. Kannten Sie das Opfer?
Ich kannte ihn flüchtig, er war selten bei uns. Aber seine Cousins kommen regelmäßig.
Die meisten, die an die Hochhaussiedlung im Märkischen Viertel denken, haben ein recht bestimmtes Bild vor Augen: Vernachlässigte Kinder, die sich zwischen den Häusern herumtreiben, überforderte Eltern, Gewalt, immer mal wieder Zwischenfälle. Wie ist es wirklich in Ihrem Viertel?
Ich glaube, wer nie in einer Hochhaussiedlung gelebt hat, kann sich das auch nicht vorstellen. Es gibt Vor- und Nachteile. Die Kinder haben alle ihre Freunde direkt bei sich. Das ganze Leben ist ein Spielplatz. Man kann seine besten Freunde treffen und muss nicht einmal das Haus verlassen. Man bekommt fast alles von allen mit. Das ist schon etwas anderes als in einer Einfamilienhaussiedlung. Alles ist dicht beieinander. Deshalb gibt es aber auch schnell Konflikte und die werden auch ausgetragen. Was die vernachlässigten Kinder angeht: Die gibt es doch überall. Der eine parkt sein Kind vor Playstation, der andere schickt es mit zwei Euro in der Hand vor die Tür und sagt „Komm erst am Abend wieder“ – beides sind Formen von Vernachlässigung. Das Märkische Viertel ist sehr bunt gemischt. Es gibt hier auch viele bürgerliche Anwohner. Aber ja, es stimmt, die Kinder sind hier öfter alleine draußen unterwegs. Das hängt aber damit zusammen, dass es hier kaum befahrene Straßen gibt, dafür aber viele Spielplätze.
Sie haben von Konflikten gesprochen. Woher kommen die?
Berlin an sich ist ja schon bunt durchmischt, aber das Märkische Viertel ist an sich nochmal sehr einzigartig und vielfältig in seiner Struktur. Hier leben 107 verschiedene Nationalitäten. Hier prallen Kulturen aufeinander. Zugleich leben die Menschen so eng beieinander, dass sie sich nicht so aus dem Weg gehen können, wie das in bürgerlichen Siedlungen vielleicht der Fall ist.
„Natürlich gibt es auch Ablehnung“
Was ist die Aufgabe des CVJM dort?
Uns gibt es hier schon seit 1970. In all der Zeit haben wir drei Schwerpunkte: Als erstes wollen wir Menschen von Jesus erzählen. Deshalb sind wir da, das ist unsere Motivation. Zweitens betreiben wir hier eine offene Jugendarbeit. Wir bieten einen Raum, den Jugendliche selbst gestalten können. Sie können hier ihre Freizeit verbringen und eigene Angebote machen. Natürlich sind wir immer als Berater da und helfen auch mit. Die Baracke soll ein Experimentier- und auch ein Schutzraum sein. Drittens wollen wir Kindern Dinge beibringen, die ihnen helfen, mit sich selbst und in der Gesellschaft besser zurecht zu kommen. Wir machen Sport, Hausaufgabenbetreuung, unternehmen Ausflüge, machen Musik, kochen, schulen die Kinder in gewaltfreier Kommunikation, also allerhand pädagogische Angebote.
Wie unterscheidet sich die christliche von der nichtchristlichen Jugendarbeit?
In erster Linie ist das die Motivation. Wir wollen den Kindern gerne zeigen, wie Jesus Menschen liebt, dass Gott sie wertschätzt und dass sie auch andere so wertschätzen können. Wir hoffen, dass sich diese Werte in unserer Arbeit zeigen und dass wir darüber ins Gespräch kommen. Wir bieten Andachten an und Gottesdienste. Es gibt bei uns auch eine christliche Gesprächsgruppe.
Wird das angenommen?
Ja. Zu uns kommen viele Muslime, orthodoxe Christen aus Osteuropa und Atheisten. Unser Raum ist so gestaltet, dass sich alle dort zuhause fühlen und auf Augenhöhe kommunizieren können. Ich sage unseren Mitarbeitern immer: Wenn ihr den Jugendlichen zuhört und euch für das interessiert, was in deren Leben eine Rolle spielt, dann erkauft ihr euch damit auch das Recht, von den Dingen zu erzählen, die in eurem Leben eine Rolle spielen. So entsteht ein Austausch über Glaubensdinge. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Aber jeder sitzt bei uns mal in der Andacht oder redet über Glaubensfragen.
Gibt es auch Ablehnung?
Natürlich. Wir haben einen Raum, darin hängen Kreuze und da finden auch die Andachten statt. Manche Kinder dürfen den wegen der Kreuze nicht betreten. Es gibt aber auch neutral gestaltete Räume, damit jeder kommen kann, auch solche Kinder, deren Eltern nicht wollen, dass sie zu Christen gehen. Wie viele das sind, kann ich nicht sagen. Die bekomme ich ja nicht mit. Ich denke, insgesamt ist die Akzeptanz groß. Die, die nichts mit Glauben zu tun haben, akzeptieren uns dennoch als sozialer Akteur im Viertel. Wir erleben eigentlich kaum Widerstand.
Jüngst hat ein Reporter der Zeit Sie besucht. Er zitiert Sie mit den Worten: „Ich bin Christ. Ich behandle Menschen so, wie Gott sie liebt. Er macht keinen Unterschied zwischen ihnen.“ Wo zeigt sich diese Haltung in Ihrer täglichen Arbeit?
Ich denke konkret an das Thema Bildung. Es gibt in unserer Gegend viele Kinder, deren Eltern sich nicht sehr dafür interessieren, ob sie gut in der Schule sind oder nicht. Viele können auch nicht so gut Deutsch. Wir versuchen den Kindern dann zu helfen, ihren Weg zu finden. Wir wollen ihnen helfen, ihr Leben zu gestalten – mit ihren Grenzen und mit ihren Gaben. Wir behandeln sie unabhängig von Religion und Herkunft. Jeder ist willkommen. Jeder soll sich wohlfühlen. Wir wollen niemanden vereinnahmen, sind aber offen für das Gespräch über den Glauben.
Hat sich seit dem Unfall, bei dem Ibrahim starb, etwas verändert im Märkischen Viertel?
Mich hat beeindruckt, dass bei allem Trubel, der auch durch die Presse verursacht wurde, die Anteilnahme und das Interesse aneinander über kulturelle Grenzen hinweg da war. Alle haben zusammengestanden und versucht, den Eltern des Opfers zu helfen. Es herrscht jetzt ein achtsameres Miteinander.
Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch!
Was ist die Aufgabe des CVJM dort?
Uns gibt es hier schon seit 1970. In all der Zeit haben wir drei Schwerpunkte: Als erstes wollen wir Menschen von Jesus erzählen. Deshalb sind wir da, das ist unsere Motivation. Zweitens betreiben wir hier eine offene Jugendarbeit. Wir bieten einen Raum, den Jugendliche selbst gestalten können. Sie können hier ihre Freizeit verbringen und eigene Angebote machen. Natürlich sind wir immer als Berater da und helfen auch mit. Die Baracke soll ein Experimentier- und auch ein Schutzraum sein. Drittens wollen wir Kindern Dinge beibringen, die ihnen helfen, mit sich selbst und in der Gesellschaft besser zurecht zu kommen. Wir machen Sport, Hausaufgabenbetreuung, unternehmen Ausflüge, machen Musik, kochen, schulen die Kinder in gewaltfreier Kommunikation, also allerhand pädagogische Angebote.
Wie unterscheidet sich die christliche von der nichtchristlichen Jugendarbeit?
In erster Linie ist das die Motivation. Wir wollen den Kindern gerne zeigen, wie Jesus Menschen liebt, dass Gott sie wertschätzt und dass sie auch andere so wertschätzen können. Wir hoffen, dass sich diese Werte in unserer Arbeit zeigen und dass wir darüber ins Gespräch kommen. Wir bieten Andachten an und Gottesdienste. Es gibt bei uns auch eine christliche Gesprächsgruppe.
Wird das angenommen?
Ja. Zu uns kommen viele Muslime, orthodoxe Christen aus Osteuropa und Atheisten. Unser Raum ist so gestaltet, dass sich alle dort zuhause fühlen und auf Augenhöhe kommunizieren können. Ich sage unseren Mitarbeitern immer: Wenn ihr den Jugendlichen zuhört und euch für das interessiert, was in deren Leben eine Rolle spielt, dann erkauft ihr euch damit auch das Recht, von den Dingen zu erzählen, die in eurem Leben eine Rolle spielen. So entsteht ein Austausch über Glaubensdinge. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Aber jeder sitzt bei uns mal in der Andacht oder redet über Glaubensfragen.
Gibt es auch Ablehnung?
Natürlich. Wir haben einen Raum, darin hängen Kreuze und da finden auch die Andachten statt. Manche Kinder dürfen den wegen der Kreuze nicht betreten. Es gibt aber auch neutral gestaltete Räume, damit jeder kommen kann, auch solche Kinder, deren Eltern nicht wollen, dass sie zu Christen gehen. Wie viele das sind, kann ich nicht sagen. Die bekomme ich ja nicht mit. Ich denke, insgesamt ist die Akzeptanz groß. Die, die nichts mit Glauben zu tun haben, akzeptieren uns dennoch als sozialer Akteur im Viertel. Wir erleben eigentlich kaum Widerstand.
Jüngst hat ein Reporter der Zeit Sie besucht. Er zitiert Sie mit den Worten: „Ich bin Christ. Ich behandle Menschen so, wie Gott sie liebt. Er macht keinen Unterschied zwischen ihnen.“ Wo zeigt sich diese Haltung in Ihrer täglichen Arbeit?
Ich denke konkret an das Thema Bildung. Es gibt in unserer Gegend viele Kinder, deren Eltern sich nicht sehr dafür interessieren, ob sie gut in der Schule sind oder nicht. Viele können auch nicht so gut Deutsch. Wir versuchen den Kindern dann zu helfen, ihren Weg zu finden. Wir wollen ihnen helfen, ihr Leben zu gestalten – mit ihren Grenzen und mit ihren Gaben. Wir behandeln sie unabhängig von Religion und Herkunft. Jeder ist willkommen. Jeder soll sich wohlfühlen. Wir wollen niemanden vereinnahmen, sind aber offen für das Gespräch über den Glauben.
Hat sich seit dem Unfall, bei dem Ibrahim starb, etwas verändert im Märkischen Viertel?
Mich hat beeindruckt, dass bei allem Trubel, der auch durch die Presse verursacht wurde, die Anteilnahme und das Interesse aneinander über kulturelle Grenzen hinweg da war. Alle haben zusammengestanden und versucht, den Eltern des Opfers zu helfen. Es herrscht jetzt ein achtsameres Miteinander.
Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch!
Die Fragen stellte Anna Lutz