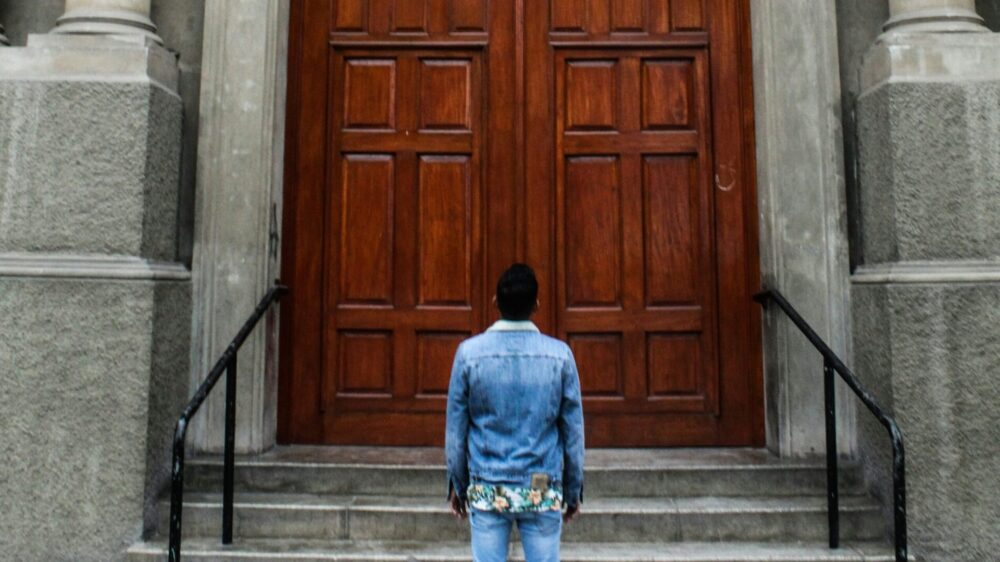Kirchenasyl wird seiner Funktion und Bedeutung nur gerecht, wenn sich die Vertreter der Kirche damit nicht außerhalb des geltenden Rechts bewegen. Vielmehr könne diese Einrichtung im Einzelfall dabei helfen, dass das Recht durchgesetzt wird: „wenn kirchliche Vertreter im konkreten Fall zur Überzeugung gelangen, dass grundgesetzliche Schutzpflichten des Staates nicht hinreichend zur Geltung“ kommen. Das betonen der Theologe Constantin Plaul und der Jurist Sönke Ahrens in einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.
Grundsätzlich müssten die Kirchen anerkennen, dass der Rechtsstaat mit seinen Regeln für ein geordnetes und friedliches Zusammenleben sorgt. Deshalb plädieren die Autoren dafür, das Kirchenasyl mit Augenmaß anzuwenden. Kirchen sollten genau hinschauen, wer sich tatsächlich auf das Asylrecht berufen könne und wo im Fall einer bevorstehenden Abschiebung rechtliche Grundsätze seitens des Staates verletzt würden. Wer etwa über ein anderes EU-Land nach Deutschland eingereist sei, falle nach der Dublin-Regel nicht unter das deutsche Asylrecht. Außerdem gälten auch in den anderen europäischen Ländern die Menschenrechtskonvention; somit sei fraglich, ob mit einer Abschiebung dorthin unzumutbare Härten verbunden wären.
Als „moralisches Korrektiv“ sei Kirchenasyl nicht nötig, da die Gesetze eines Rechtsstaates die moralischen Überzeugungen einer Gesellschaft widerspiegelten. Kirchen sollten sich „im Klaren sein, dass politischer Aktivismus in diesem Rahmen kontraproduktiv wäre“. Effektiver als Kirchenasyl in Einzelfällen zu gewähren, wäre es, so schreiben Plaul und Ahrens, wenn sich die Kirchen stärker in den öffentlichen Diskurs darüber einbringen würden, „wie gesellschaftliche Akzeptanz für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen geschaffen werden kann“. Die Achtung der Menschenwürde und das Gebot der Nächstenliebe böten dafür die Grundlage. Die Frage sei jedoch, inwiefern die Gesellschaft bereit sei, die Konsequenzen daraus für den Umgang mit Flüchtlingen zu akzeptieren und sie umzusetzen.